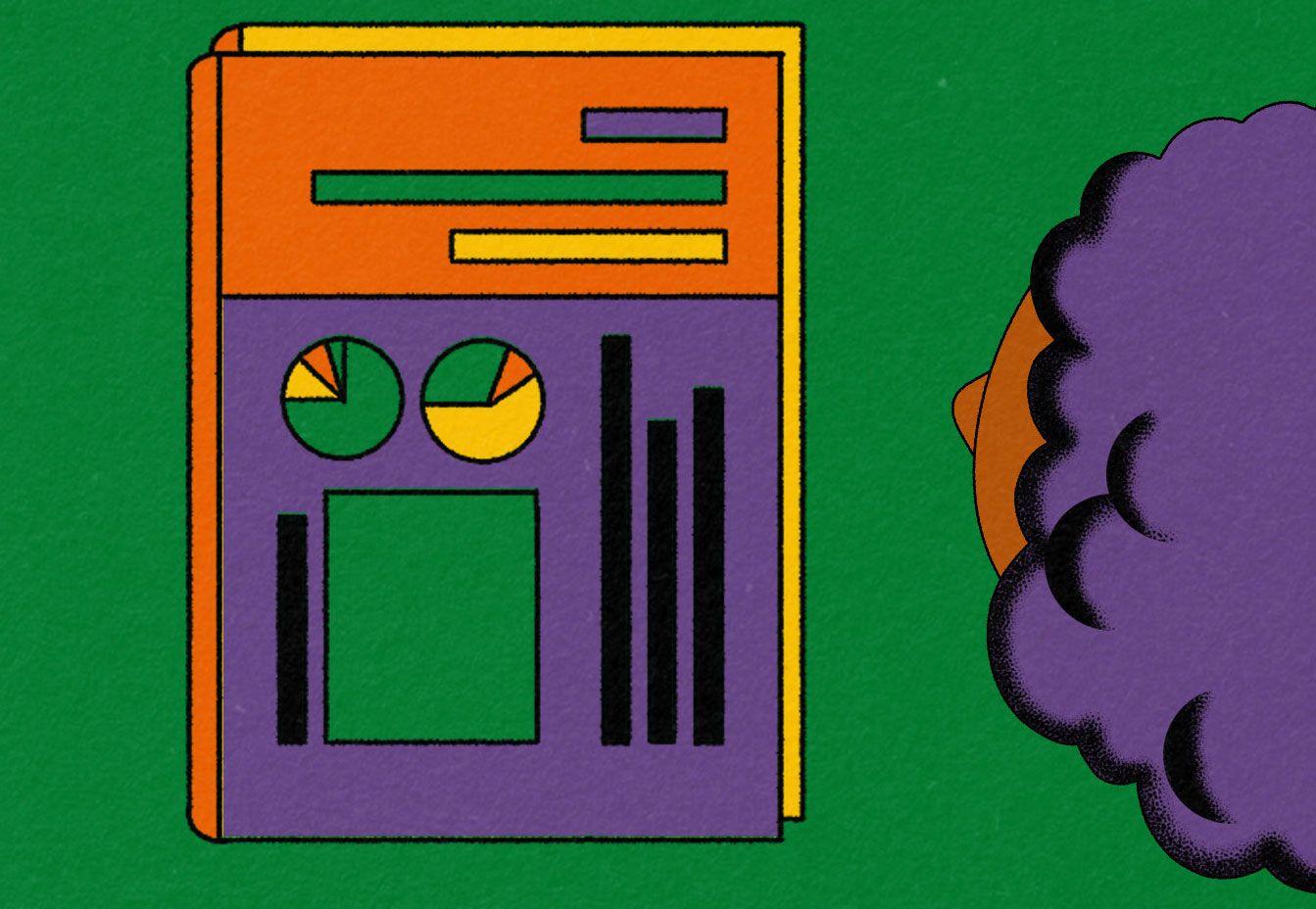Wissen Sie wie die Umweltsituation und die soziale Lage in Ihrem Kiez ist? Darüber gibt nun der „Basisbericht Umweltgerechtigkeit“ des Berliner Senats Auskunft. Er macht deutlich: In der Hauptstadt konzentrieren sich Lärm, schlechte Luft, Hitze und Mangel an Grünflächen vor allem in den armen Quartieren. Berlin gilt mit seinem Monitoring-Projekt bundesweit und sogar international als Vorreiter in Sachen Umweltgerechtigkeit. Doch ein gut gemeintes Verwaltungsprojekt allein kann die strukturellen ökologischen Ungleichheiten nicht auflösen. Dem stehen mächtige (Kapital-)Interessen entgegen. Darauf deutet auch eine Reihe von sozial-ökologischen Konflikten in den Berliner Brennpunkten der Umwelt-Ungerechtigkeit hin. Die Kämpfe knüpfen an die Ursprünge der Environmental Justice-Bewegung an.
Die Stadt Niagara Falls (USA) in den späten 1970er Jahren: In dem Viertel Love Canal treten Chemikalien an die Erdoberfläche, Kinder erkranken an Krebs. Die oft armen Anwohner*innen schließen sich zusammen und entdecken, dass ihre Siedlung ohne ihr Wissen auf einer ehemaligen Giftmülldeponie errichtet wurde. Durch eine starke Grasswurzel-Kampagne können sie schließlich ihre Umsiedlung erreichen.
Der Love Canal-Skandal gilt als Geburtsstunde der Umweltgerechtigkeitsbewegung in den USA. In den folgenden Jahren entstanden an vielen Orten ähnliche Kämpfe. Ihre Gemeinsamkeit: Sozial schwache und/oder migrantische Menschen werden selbst aktiv, um gegen Mülldeponien, Industrieanlagen und Schnellstraßen in ihren Stadtvierteln zu protestieren. Von den USA aus verbreitete sich der Ansatz in der ganzen Welt. Überall wenden sich Graswurzel-Initiativen gegen gesundheitsschädliche Umweltbelastungen und verlangen gleichen Zugang zu öffentlichen Umweltgütern wie etwa Parks. Sie hinterfragen die herrschaftförmige Produktion ökologischer Ungleichheiten. Und sie zielen auf eine radikale sozial-ökologische Transformation und Demokratisierung der Gesellschaft.
Anfang des Jahrtausends führte eine Fach-Community aus Wissenschaftler*innen, Verwaltungsmitarbeiter*innen und NGO-Referent*innen das Konzept Umweltgerechtigkeit auch in Deutschland ein. Anders als in der Bewegungstradition sahen sie in erster Linie städtische Verwaltungen als handelnde Subjekte. Diese sollten alle relevanten Akteure (also auch Kapitalvertreter*innen) einbeziehen, um konkrete ökologische Gerechtigkeitsprobleme zu lösen. Dafür fingen sie zunächst an, Daten über den Zusammenhang zwischen sozialer Lage, Umweltqualität und Gesundheit in Deutschland zusammenzutragen. Auch wenn diese noch lückenhaft sind, wurde schnell deutlich: Quartiere, in denen viele Menschen aus niedrigen sozialen Schichten, aus bildungsfernen Milieus und/oder mit Migrationshintergrund leben, sind deutlich stärker von negativen Umwelteinflüssen betroffen als Menschen in wohlhabenden und weißen Nachbarschaften.
Die unterprivilegierten Teile der Arbeiter*innenklasse wohnen häufiger an stark befahrenen Straßen und sind stärker Lärm und Luftschadstoffen ausgesetzt. Ihre Wohnungen sind öfter von Feuchtigkeit, Schimmel und Bauschadstoffen belastet. Sie leiden mehr unter Hitzewellen, weil sich die Wärme in ihren eng bebauten Vierteln staut. Nicht zuletzt haben sie weniger Parks und Gewässer im unmittelbaren Wohnumfeld, die die Umweltbelastungen abmildern könnten. Wer in Deutschland arm ist, lebt in einer schlechteren Umwelt, wird häufiger krank und stirbt früher.
Deswegen setzen sich die Vertreter*innen von Umweltgerechtigkeit dafür ein, den Ansatz in staatlicher Rahmengesetzgebung und Verwaltungspraxis zu verankern. 2019 haben sie einen wichtigen Zwischenerfolg erzielt: Der rot-rot-grüne Senat in Berlin hat Anfang des Jahres den „Basisbericht Umweltgerechtigkeit – Grundlagen für die sozialräumliche Umweltpolitik“ veröffentlicht. Darin kartiert und bewertet die Landesregierung detailliert die soziale und ökologische Situation in den Kiezen. Damit verfolgt die Berliner Landesregierung das Ziel, mehr Umweltgerechtigkeit in der wachsenden Hauptstadt zu schaffen und einen ressortübergreifenden Ansatz zu entwickeln, um Umwelt-, Gesundheits- und Sozialpolitik besser zu verzahnen.
Die rot-rot-grüne Koalition im Abgeordnetenhaus arbeitet an einem Maßnahmenkatalog. Nach Veröffentlichung des Senatsberichts scheint das Projekt nun jedoch etwas in der Luft zu hängen und es ist unklar, wann es mit welchen Schritten weitergeht. Ein nächster sinnvoller Schritt wäre, das Monitoring noch zu verfeinern und in festen Abständen zu wiederholen, um zu wissen, wie sich die Indikatoren für Umweltgerechtigkeit in den einzelnen Quartieren entwickeln. Darauf aufbauend bräuchte es einen Umsetzungsfahrplan, der Umweltgerechtigkeit sowohl auf der Planungsebene verankert als auch konkrete Aktionspläne beinhaltet. Nicht zuletzt müsste sichergestellt werden, dass die Umweltgerechtigkeitspolitik auch in Zukunft in der Landesverwaltung personell gut aufgestellt ist.
Umweltmonitoring und sozial-ökologische Konflikte
Doch zunächst zu den Ergebnissen der Befragung: Auch in Berlin sind Umweltbelastungen sozial-räumlich ungleich verteilt. Wo sich Lärm-, Luft- und Hitzebelastung konzentrieren und Grünräume fehlen, gibt es auch viele soziale Probleme. Die sozial-ökologischen Mißstände ballen sich in der erweiterten Innenstadt (die über den S-Bahn-Ring hinausreicht). In den eng bebauten Gründerzeitvierteln wohnen die Leute dichter zusammen und die Umweltbedingungen sind ungünstig. Dort liegen die meisten mehrfach belasteten Quartiere: Die Armen in der Innenstadt tragen weit überdurchschnittlich die gesundheitlichen Lasten der Umweltverschmutzung. Viele wohlhabende Menschen leben dagegen in den locker bebauten, grünen Ortsteilen am Stadtrand, wo die Umweltsituation zumeist gut ist. Auch arme Hochhaussiedlungen in der Peripherie leiden unter ökologischen Problemen – zum Beispiel das Falkenhagener Feld (Spandau), das Märkische Viertel (Reinickendorf), Hohenschönhausen, Marzahn oder Hellersdorf.
Doch diese Konstellation verändert sich: Seit Jahren kaufen sich Investoren massiv in das „Betongold“ von Berlin ein. Vor allem in der Innenstadt steigen die Preise. Mit der Gentrifizierung ziehen einkommensstarke Gruppen in die angesagten Szeneviertel, obwohl sich die Umweltsituation nicht unbedingt verbessert hat. Die langjährigen Mieter*innen dort sind oft ärmer und müssen sich immer mehr einschränken, um sich die explodierenden Mieten noch leisten zu können. Stichwort: Verdrängung aus dem Lebensstil. Gleichzeitig sind in diesen Vierteln viele Linke und allgemein politisch Aktive zu finden. Dort nehmen seit einigen Jahren sozial-ökologische Konflikte zu, die wir als Kämpfe um Umweltgerechtigkeit verstehen können.
- Auf dem Tempelhofer Feld verdichten sich Umweltgerechtigkeitskonflikte wie unter einem Brennglas: Über lange Jahre litten die sozial schwachen Menschen im östlich angrenzenden Nord-Neukölln nicht nur unter urbanen Hitzestaus und einem Mangel an grünen Erholungsräumen, sondern auch unter dem Lärm des Flughafen Tempelhof. Nachdem dieser 2008 geschlossen wurde, trugen ungehorsame Aktionen wie „Squat Tempelhof“ wesentlich dazu bei, dass das Gelände 2010 für die Berliner*innen geöffnet wurde. Die Anwohner*innen profitieren nun von einem gut zugänglichen öffentlichen Freiraum. In den folgenden Jahren eroberten viele Berliner*innen und verschiedene Graswurzel-Initiativen das Feld für sich. So auch das Allmende-Kontor, das mit dem Urban Garden am Ostrand des Areals ein praktisches Commons schuf. Der Garten diente auch als emblematischer Ort des freien Feldes, als die damalige Große Koalition in Berlin plante, Teile des ehemaligen Flughafens zu bebauen – vor allem mit Wohnungen im Hochpreissegment. Dagegen regte sich breiter Widerstand. Die Initiative „100 Prozent Tempelhofer Feld“ konnte die Pläne mit einem erfolgreichen Volksbegehren abwenden. Ein zentrales Argument: Die Luxusbebauung hätte den positiven Effekt untergraben, den das Feld für das Mikroklima der umliegenden sozial-ökologisch belasteten Kieze hat.
- Doch der grüne Freiraum bringt auch neue Widersprüche mit sich. Mit der Schließung des Flughafens begannen Investoren, sich im angrenzenden Schillerkiez massiv in den Wohnungsbestand einzukaufen. Preise und Mieten gingen durch die Decke. Die Bevölkerung im Kiez wurde teilweise ausgetauscht. Die neuen Bewohner*innen sind jünger, wohlhabender und stärker akademisch geprägt als die Alteingesessenen. Kritische Stadtforscher*innen nennen diesen Prozess „Green Gentrification“. Gegen solche Verdrängungsprozesse sind seit Jahren örtliche Recht auf Stadt–Gruppen aktiv. Zum Beispiel das Gesundheitskollektiv: Seit 2014 arbeitet eine Gruppe von Aktivist*innen daran, ein alternatives Stadtteil-Gesundheitszentrum in Nord-Neukölln aufzubauen. Darin wollen sie eine solidarische Gesundheitsversorgung mit politischen Projekten gegen Armut, hohe Mieten, Rassismus und Umweltbelastung verbinden.
- Mit dem Ausbau der Berliner Stadtautobahn A100 wird das Dogma der autogerechten Stadt fortgesetzt. Gegenwärtig wird der 16. Bauabschnitt vom Dreieck Neukölln bis zur Anschlussstelle am Treptower Park gebaut. Es könnte noch schlimmer werden: Im Bundesverkehrswegeplan ist ein 17. Bauabschnitt fest vorgesehen – über die Spree entlang der Ringbahn zwischen Friedrichshain und Lichtenberg. Dadurch wird eine Schneise der Zerstörung durch sozial und ökologisch zum Teil hoch belastete Kieze geschlagen. Das Gebiet, durch das sich die Autobahn-Verlängerung zieht, ist schon heute durchgehend von urbanen Hitzestaus und in Teilen von einem Mangel an Grünflächen geprägt. Der Bereich um das Ostkreuz gilt als einer der Hitze-Brennpunkte Berlins, wenn der Klimawandel voll durchschlägt. Die Magistrale hat schon Kleingärten vernichtet und wird nach Fertigstellung die Anwohner*innen zusätzlich mit Lärm und Autoverkehr plagen. Nicht nur die Bundespolitik forciert den Ausbau. Auch die rechte Opposition aus CDU, FDP und AFD sowie Teile der regierenden SPD setzen sich dafür ein, den innerstädtischen Autobahnring zu vervollständigen. Doch es ist mit Widerstand zu rechnen. Den langjährigen Protesten des „Aktionsbündnisses A100 stoppen“ schließen sich nun auch grün bewegte Friedrichshainer*innen und die Technoclubs an, die der Autotrasse weichen sollen.
- Schlechte Luft, Hitze und verbreitete Armut prägen das Leben in den Plattenbau-Siedlungen in Kreuzbergs Norden. Dazu kommt oft ein miserabler Zustand der Wohnungen. Im Jahr 2013 übernahm die Deutsche Wohnen (DW) die Hochhäuser am südlichen Kottbusser Tor von den Unternehmen GSW bzw. Hermes. Dort hatten sich schon 2011 Mieter*innen zur Initiative Kotti&Co zusammengetan. Einer der Gründe war und ist, dass die wechselnden Eigentümer überhöhte Nebenkosten kassieren, aber die Häuser verkommen lassen und Heizungen im Winter teilweise mehrere Wochen ausfallen. Was der Deutsche Wohnen höhere Profite beschert, gefährdet die Gesundheit der Bewohner*innen. Eine ähnliche Strategie verfolgte die DW in der benachbarten Otto-Suhr-Siedlung beim Moritzplatz. Nachdem sie die Wohnungen teilweise erst verfallen ließ, kündigte sie 2016 umfangreiche Modernisierungen an – und massive Mieterhöhungen. Auch dort organisierten sich viele der sozial schwachen Mieter*innen und konnten durch öffentliche Proteste dem Konzern erhebliche Zugeständnisse abtrotzen. Weil die DW auch in vielen anderen Siedlungen auf eine ähnliche Strategie setzt, hat sich inzwischen ein stadtweites Bündnis gebildet, das mit einem Volksbegehren die Enteignung des Unternehmens erreichen will.
- In den Einflugschneisen des Flughafen Tegel im Norden von Berlin leben überdurchschnittlich viele arme Menschen, die ohnehin mit einer hohen Umweltbelastung zu kämpfen haben. Die betroffenen Quartiere sind im Westen unter anderem Spandau Zentrum und das Falkenhagener Feld. Im Osten sind es die Stadtteile Reinickendorf, Wedding und Gesundbrunnen. 300.000 Anwohner*innen leiden unter dem Lärm der täglich rund 500 Starts und Landungen. Obwohl Tegel eigentlich schon vor Jahren geschlossen werden sollte, ist er weiterhin in Betrieb, weil der skandalträchtige Berlin-Brandenburger Flughafen BER im Süden der Stadt immer noch nicht eröffnet wurde. Ende 2015 startete die FDP aus parteitaktischen Gründen ein Volksbegehren mit der Forderung, den Flughafen offen zu halten. Dagegen setzen sich das Bündnis „Tegel schließen – Zukunft öffnen“ sowie die rot-rot-grüne Koalition für die Schließung ein. Beim Volksentscheid im Herbst 2017 sprach sich eine Mehrheit der Berliner*innen für die Offenhaltung aus. Trotzdem gilt die Schließung als sicher. Auch in den meisten lärmbelasteten, armen Quartieren stimmte die Mehrheit für den Flughafen. In einer Befragung äußerten viele Anwohner*innen die Befürchtung, dass durch eine Umnutzung des Geländes ihre Mieten steigen würden. Nicht ohne Grund: Der Senat plant, vor allem Forschung und Greentech-Unternehmen anzusiedeln, was eine massive Aufwertung der Gegend bedeuten würde.
Urbane ökologische Klassenpolitik
Was lernen wir daraus für eine linke Politik der urbanen Umweltgerechtigkeit? Die Beispiele zeigen: Eine neoliberale, an Wachstum und Unternehmensinteressen orientierte Politik ist eine zentrale Ursache von sozial-ökologischen Missständen. Dagegen setzen sich Bürgerinitiativen, Nachbarschaftorganisationen und linke Gruppen für Umweltgerechtigkeit ein. Dabei können sie durchaus ein Bündnis mit progressiven Akteuren in Wissenschaft, Parteien und Stadtverwaltung eingehen, die das Thema auf die kommunalpolitische Agenda setzen wollen. Aber es muss klar sein, dass nicht alle Stakeholder am gleichen Strang ziehen. Wer die strukturellen Ursachen der Umweltungerechtigkeit angehen will, muss sich mit mächtigen Akteuren anlegen – mit dem Immobilienkapital, der Autolobby und ihren Unterstützer*innen in der Politik.
Bei dem notwendigen Umbau der Stadt taucht eine Reihe von Widersprüchen auf, die aus einer linken Sicht konkrete Maßnahmen und weitergehende Richtungsforderungen nahelegen. Keine davon ist neu. Doch die Perspektive der Umweltgerechtigkeit verleiht den Problemen neue Brisanz – und ihrer Lösung zusätzliche Dringlichkeit. Außerdem eröffnet sie neue Möglichkeiten, Kämpfe um Gesundheit, Klimagerechtigkeit und Recht auf Stadt zu verknüpfen. Denkt man die Veränderungen konsequent zu Ende, zeichnen sich darin erste Konturen einer öko-sozialistischen Stadt ab:
- Immobilienunternehmen enteignen: Die Konsequenz aus dem Phänomen Green Gentrification darf nicht sein, darauf zu verzichten, die Umweltsituation in den Quartieren zu verbessern und die Lebensqualität für die Anwohner*innen zu steigern. Das zentrale Problem sind der kapitalistische Immobilienmarkt und die renditeorientierten Investoren, die auch für den miserablen Zustand vieler Wohnungen verantwortlich sind. Sie sind kein willkommener Partner, sondern ein wesentlicher Gegner auf dem Weg zu mehr Umweltgerechtigkeit. Die privatwirtschaftlich kontrollierten Immobilienbestände müssen enteignet und demokratisiert werden.
- Autos aus den Städten verbannen: Verbrennungsmotoren sind eine wesentliche Quelle von Lärm- und Luftbelastung. Auch Elektroautos können höchstens eine randständige Rolle in einer tatsächlich nachhaltigen Verkehrswende spielen. Stattdessen müssen Fahrradfahrer*innen und Fußgänger*innen, Bus und Bahn, Taxis und Carsharing die Straßen erobern. Für eine ernsthafte Umweltgerechtigkeitspolitik muss das Dogma der autogerechten Stadt abgelöst werden von einer Praxis der menschenfreundlichen und autofeindlichen Stadt.
- Städte zu grün-blauen Oasen machen: Notwendig wäre eine ganz neue Flächen- und Bodenpolitik. Die vordringlichste Aufgabe bestünde darin, dem Auto massiv den Platz streitig zu machen und den Wildwuchs fragwürdiger Industrieanlagen, Hotels und Bürogebäude einzuschränken. Aber nicht jede Verdichtung lässt sich vermeiden, weil es einen realen Zuzug von Menschen in die Großstädte gibt, die dort eine größere Lebensqualität empfinden. Umso wichtiger ist es, möglichst viele großflächige Grünräume und Wasserflächen zu erhalten und neu zu schaffen. Wo das nicht möglich oder durchsetzbar ist, ist es umso wichtiger, Straßen und Gebäude kleinteilig zu begrünen. Ansätze gibt es viele: Stadtbäume, Mittelstreifenbepflanzung, Wasserspiele, Hof-, Dach- oder Fassadenbegrünung. Darüber hinaus geht es darum, Häuser, Straßenräume, Plätze und naturnahe Freiflächen nach den Bedürfnissen der Menschen zu gestalten. Die Bewohner*innen müssen sich in ihnen wohlfühlen und sie nach ihren Wünschen aneignen können.
Eine Praxis der Umweltgerechtigkeit im Sinne einer ökologischen Klassenpolitik versucht, die sozial Marginalisierten und Ausgebeuteten für den ökologischen Umbau zu gewinnen, ihre Interessen darin zu integrieren und dieses Projekt im Kampf gegen die herrschenden Akteure durchzusetzen.