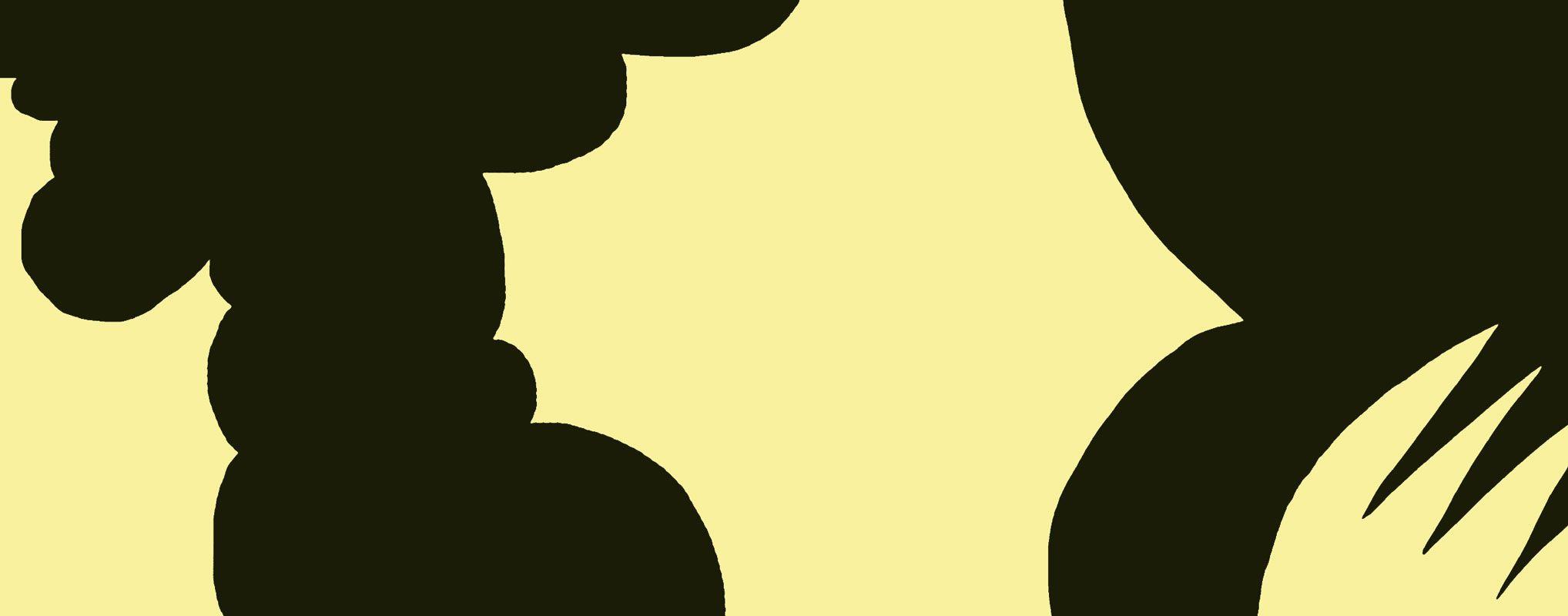Das Thema Arbeitszeitverkürzung geistert in seltsamer Weise durch die Feuilletons. Berichtet wird dort über eine GenerationZ, die quiet quitting betreibe. Dabei geht es nicht etwa um »innere Kündigung«, sondern darum, dass insbesondere Berufseinsteiger*innen teilweise auf verkürzte Arbeitszeiten bestehen. Manche sehen sie deshalb als Pionier*innen einer neuen Offensive für Arbeitszeitverkürzung, deren Arbeitsmarktmacht (Demografie) und Bildungskompetenz (digital generation) sich mit dem Insistieren auf Work-Life-Balance sowie einem von Gesundheits- und Umweltbewusstsein getragenen politischen Engagement verbinden. Aus konservativen Kreisen hingegen wird »den Jungen« vorgeworfen, faul und hedonistisch zu sein – eine Haltung, die in Zeiten von Fachkräftemangel und Sorgen über die künftige Finanzierbarkeit des Rentensystems, die eher eine Verlängerung von Wochen- und Lebensarbeitszeit nahelegen würden, als rücksichtslos gebrandmarkt wird. Beide Seiten übersehen, dass es hier nicht um einen Generationenkonflikt geht, sondern um Auseinandersetzungen um die Verteilung von gesellschaftlicher Zeit und gesellschaftlichem Reichtum.
Generation Z
Die Vorstellung von einer Generation, die durch die spezifischen Umstände ihrer Adoleszenzzeit geprägt ist und sich klar von früheren oder späteren Jahrgängen unterscheidet, mag in exzeptionellen geschichtlichen Situationen ihre Berechtigung haben. Über Kriegs- und Nachkriegserfahrungen wird mitunter so berichtet. Allerdings handelt es sich selbst hier um Zeiten politischer Polarisierung, die von den damals Jungen sehr unterschiedlich verarbeitet wurden, je nachdem, wo sie sozioökonomisch oder politisch standen. Auch Konstrukte wie die »Silent Generation« der Kriegs- oder die »Baby Boomer« der Nachkriegsjahre stehen zum einen nicht für die ganze damalige »Jugend« und sind zum anderen nicht auf eine Alterskohorte begrenzt. Vielmehr strahlen gesellschaftliche Konflikte und Weichenstellungen darüber hinaus.
Das Generationenkonstrukt überzeugt nicht, weil Homogenität einer Altersgruppe postuliert wird, die in höchst unterschiedlichen sozialen Lagen steckt. Auch heute sind mit dem Eintritt in die Arbeitswelt vielfältige Erfahrungen sozialen Auf- oder Abstiegs, von Anerkennung und Selbstermächtigung oder aber von sozialer Fragmentierung und Deprivation verbunden. In die Generation Z wird eingruppiert, wer grob gesagt in dem Jahrzehnt des Übergangs in das neue Jahrtausend geboren ist. Doch damit verknüpfte positive Erwartungen erfüllen sich nur für diejenigen, die über höhere Bildungsabschlüsse verfügen, in die »Facharbeiterlücke« stoßen und mittlere bis hohe Einkommenspositionen erreichen. Das gilt nicht für alle in dieser Altersgruppe, aber umgekehrt auch für etliche, die nicht dazu gehören. Offenkundig geht es hier nicht in erster Linie um generationelle, sondern um Klassenprägungen.
Verfügung über Zeit als Klassenfrage
Für Pierre Bourdieu ist die soziale Stellung von Individuen bekanntlich von ihrer Kapitalausstattung abhängig: in erster Linie vom Zugriff auf ökonomisches Kapital, dann von der Ausstattung mit kulturellem und sozialem Kapital, schließlich von der Übersetzung in symbolisches Kapital. Ausschlaggebend ist die Disposition über Zeit, beispielsweise »bei der Umwandlung von ökonomischem in kulturelles Kapital. Das beste Maß für kulturelles Kapital ist zweifellos die Dauer der für seinen Erwerb aufgewendeten Zeit.« (Bourdieu 1997, 72) Wer zwei Jobs benötigt, um über die Runden zu kommen, wer nach der Arbeit erschöpft in den Sessel fällt oder in der Produktion bzw. beim Discounter Schichtarbeit leistet, für den und für die sind die familiäre Erziehung und das Bildungssystem von restriktiven Klassenlinien durchzogen. In den Lebenswelten »verkannter Leistungsträger:innen« (Mayer-Ahuja/Nachtwey 2021), deren Niedriglöhne gerade einmal für prekäre Wohnlagen reichen, ist alles knapp: Kapital und Zeit. Man arbeitet, wenn man denn einen Job findet, oft rund um die Uhr, hat kaum Zeit und Geld, um den Kindern Zugang zu sozialen Netzwerken oder kulturellen Aktivitäten zueröffnen. »Work-Life-Balance« ist auch hier ein viel geträumter Traum – allerdings einer, dessen Verwirklichung man sich nicht leisten kann.
In anderen Teilen der arbeitenden Klasse sind dessen Verwirklichungschancen besser. Aber auch dort sind Nöte unübersehbar. Die Kapitalausstattung ist günstiger, aber überlange Arbeitszeiten sind an der Tagesordnung: sei es in Projektarbeit oder in der Auftragslage angepassten flexiblen Arbeitszeitsystemen. Der Neuaufnahme der Arbeitszeitpolitik in den Gewerkschaften in der zweiten Hälfte der 2010er-Jahre lag der mehrheitliche – durch große Beschäftigtenbefragungen unterlegte – Wunsch zugrunde, mehr Zeit für die Erziehung der Kinder, für die Pflege von Angehörigen, für die eigene Erholung, Freizeit und Bildung zu haben. Diese Bedürfnisse sprengen offenkundig jede Generationenzuschreibung, werden sie doch von Beschäftigten in jungen wie in mittleren Jahren formuliert.
Kämpfe um Zeit
Vier Jahrzehnte ist es her, dass IG Metall und IG Druck und Papier (später IG Medien) 1984 in einem langen Arbeitskampf den Einstieg in die 35-Stunden-Woche erstreikten. Mehr Zeit zum Leben, Lieben, Lachen: Dieser Slogan zierte jene Transparente mit der aufgehenden Sonne, die damals durch zahlreiche Städte getragen wurden. Arbeitszeitverkürzung – das stand für die Hoffnung auf teilweise Befreiung von der (Erwerbs-)Arbeit, die mit einer schrittweisen Befreiung in der (Erwerbs-)Arbeit einhergehen sollte. In Westdeutschland konnte nur ein kleiner Teil der Beschäftigten davon profitieren; in den ostdeutschen Bundesländern dokumentiert sich deren noch geringere sozioökonomische Macht nicht zuletzt darin, dass trotz staatsbürgerlicher »Einheit« Stunde um Stunde unentgeltlich länger gearbeitet wird als im Westen. Das heißt: mehr Zeit in Fremdbestimmung und Ausbeutung, weniger Zeit zum Leben, Lieben, Lachen– und zur Anhäufung von sozialem und kulturellem Kapital, das eine bessere Zukunft verspricht.
Die Geschichte der Kämpfe um die 35-Stunden-Woche ist mehrfach beschrieben und nachgezeichnet worden.[1] Ihnen haftet, wenn überhaupt, nur peripher eine generationenspezifische Bedeutung an. Interessanter ist, dass sie als Gegenbewegung zu einem Zyklus von Kämpfen gehören, die ab Ende der 1970er-Jahre den »Klassenkampf von oben« einleiteten, durch den sich der Neoliberalismus in Großbritannien (Thatcher), in den USA (Reagan) und (in abgeschwächter Form) 1982 auch in Westdeutschland durchsetzen konnte.
Schnee von gestern? Absolut nicht! Bis heute ist unter Gewerkschaftsmitgliedern die 1984er-Auseinandersetzung präsenter und identitätsstiftender als vieles, was danach erfolgte. Das Thema Arbeitszeitverkürzung steht damals wie heute für die Hoffnung auf mehr Zeitsouveränität – eine Hoffnung, deren Erfüllung keiner Generation je zugefallen ist, sondern um die stets gekämpft wurde– im Großen wiein den kleinen Versuchen von Unternehmen, Arbeitszeiten unter der Hand zu verlängern, die Marx als »knabbern und knapsen« unter anderem an Pausenregelungen beschrieben hat.
Privileg für manche und Problem für andere
Bei denjenigen, die sich bewusst gegen Vollzeitarbeit in fachlich anspruchsvollen Jobs entscheiden (auf sie konzentrieren sich Debatten über quiet quitting oder eine Generation Z), handelt es sich in aller Regel um vergleichsweise höher qualifizierte Beschäftigte, die selbst in Teilzeit ein auskömmliches Einkommen erwarten können. Ihnen steht die wachsende Gruppe der Bezieher*innen von Niedriglöhnen (aktuell etwa jede*r vierte Erwerbstätige) gegenüber, für die selbst eine Vollzeitstelle mit »Armut trotz Arbeit« einhergeht. Etwa vier Millionen Menschen hatten (laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) im Jahr 2021 sogar mehrere Jobs. Statt Arbeitszeitverkürzung praktizieren sie Arbeitszeitverlängerung, um ihre Lebenshaltungskosten bezahlen zu können. Länger statt kürzer zu arbeiten ist auch der Wunsch vieler Frauen in Teilzeit- oder geringfügiger Beschäftigung beispielsweise im Einzelhandel und in der Gebäudereinigung. Arbeitszeitverkürzung ist deshalb keine Forderung »für alle«. Während sie für Vollzeitbeschäftigte, die regelmäßig Überstunden machen, ein großer Fortschritt wäre, bräuchten die strukturell Unterbeschäftigten, darunter sehr viele Frauen, eigentlich eine Ausweitung ihrer Arbeitszeiten, die angesichts der von vielen Unternehmen praktizierten Zersplitterung von Vollzeitstellen in Teilzeit- und Minijobs schwer zu erreichen ist. »Kurze Vollzeit für alle«, nicht allgemeine Arbeitszeitverkürzung, sollte demnach das Ziel einer zeitgemäßen arbeitszeitpolitischen Initiative lauten.
Arbeitszeitverkürzung als Selbstverteidigung
Selbst bei denjenigen, die »freiwillig« ihre Arbeitszeit reduzieren, ist oft schwer zu entscheiden, ob dies in Befreiungsabsicht oder doch eher als Akt der Selbstverteidigung erfolgt. In vielen Bereichen der Arbeitswelt ist der Druck auf Beschäftigte deutlich gewachsen. Immer mehr Aufgaben sollen mit immer weniger Personal erledigt werden. Daher müssen sich viele möglichst flexibel auf ein dauerhaft zu hohes Arbeitsvolumen und auf stetig wechselnden Arbeitsanfall einstellen. Kinderbetreuung, Hobbys, Zeit für Erholung, Weiterbildung oder die Entwicklung neuer Interessen – all das steht dann unter dem Vorbehalt, »wenn es der Job erlaubt«. Im Index »Gute Arbeit« des Deutschen Gewerkschaftsbunds gaben im Jahr 2017 über 40 Prozent der Befragten an, sie seien »sehr häufig oder oft nach der Arbeit zu erschöpft, um sich um private oder familiäre Angelegenheiten zu kümmern« – eine Erfahrung, die in den Folgejahren immer wieder bekräftigt wurde. Am Beispiel der Pflege lässt sich studieren, was dies bedeutet: Es fehlt an qualifizierten Beschäftigten, weil die (durch die Ökonomisierung des Gesundheitswesens verschärften) Arbeitsbedingungen viele Fachkräfte zwingen, vorzeitig auszuscheiden oder auf eigene Kosten die Arbeitszeit zu reduzieren, weil sie die körperlichen und psychischen Belastungen nicht mehr aushalten wollen oder können. Damit steigt der Druck auf die verbliebenen Beschäftigten, die Arbeitsverdichtung schreitet fort, der Job wird noch unattraktiver – ein Teufelskreis. Wenn sich junge Menschen, die diese Option haben, tatsächlich gegen Vollzeitarbeit entscheiden, dürfte das oft weniger mit Arbeitsscheu oder einem hedonistischen Lebensstil als mit dem abschreckenden Beispiel ausgelaugter und gehetzter Kolleg*innen zu tun haben. Wer es sich irgend leisten kann, mag zu Recht sagen: So will ich nicht enden.
Ein gesellschaftspolitisches Projekt
Die Entscheidung gegen Vollzeitarbeit ist oft eine individuelle oder bestenfalls im Haushaltskontext abgestimmte Angelegenheit, für die man notgedrungen Opfer in Form von reduziertem Einkommen und höherer Arbeitsintensität bringt. Mitte der 1980er-Jahre war mit Arbeitszeitverkürzung hingegen ein gesellschaftspolitisches Reformprojekt verbunden. Die Zeit sollte anders verteilt werden – zwischen denjenigen, die Arbeitsplätze hatten, und denjenigen, die sie im Zeichen von Massenarbeitslosigkeit verloren, aber auch zwischen Männern und Frauen, Jungen und Alten. Es ging nicht um eine individuelle Notbremse, sondern darum, das soziale Leben neu zu organisieren. Zudem wurde nicht nur um die Umverteilung von Zeit zwischen Arbeitenden gekämpft, sondern auch um eine Umverteilung von gesellschaftlichem Reichtum durch die Forderung nach vollem Lohnausgleich. Und weil Arbeitszeitverkürzung in aller Regel zu Arbeitsverdichtung führt, stand– insbesondere in der Druckindustrie – die Forderung nach Personalausgleich auf der gewerkschaftlichen Agenda.[2]
Und heute? Die Entscheidung für Teilzeitarbeit mit entsprechendem Lohnverzicht wird vor allem von Frauen mit Familienpflichten als Antwort auf den stummen Zwang der Verhältnisse genutzt, oft erzwungenermaßen. Individuelle Arbeitszeitverkürzung als Kompensation für wachsenden Leistungsdruck und Flexibilisierung hingegen ist eine freiwillige Option derjenigen, die sich das leisten können. Vor der Pandemie gab es jedoch erste Initiativen, die Entscheidung zwischen Geld und mehr freier Zeit zum Gegenstand kollektiver Regulierung zu machen. Die Gewerkschaft IG Metall setzte (ähnlich wie etwa die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft) 2018 einen Tarifvertrag durch, der es bestimmten Beschäftigtengruppen (Eltern kleiner Kinder, Menschen mit pflegebedürftigen Angehörigen, Schichtarbeiter*innen) erlaubte, selbst darüber zu entscheiden, ob sie die tariflich verhandelte Lohnerhöhung ausgezahlt bekommen oder in mehr freie Zeit umwandeln wollten. Das war ein Einschnitt: Wahlmöglichkeiten von Beschäftigten in Bezug auf die eigene Arbeitszeit – nicht abhängig davon, was man gegenüber Vorgesetzten individuell heraushandeln kann, sondern auf Grundlage kollektiv festgeschriebener Rechtsansprüche, die man gemeinsam in einem sehr lebhaften Arbeitskampf erstritten hatte. Während 2018 kein Lohn- oder Personalausgleich vorgesehen war, wird aktuell in der Stahlindustrie von der IG Metall die Einführung einer Vier-Tage-Woche mit (Teil-)Lohnausgleich gefordert. Derlei tarifpolitische Initiativen sind ein immenser Fortschritt gegenüber der individuellen »Entscheidung«, zugunsten von mehr Lebensqualität auf einen Teil des Gehalts zu verzichten.
Von einer breiten gesellschaftspolitischen Bewegung für eine Umverteilung von gesellschaftlicher Zeit und gesellschaftlichem Reichtum sind wir jedoch noch weit entfernt. Ankerpunkt dafür könnte eine »kurze Vollzeit« sein: um die 30 Wochenstunden für alle, verbunden mit Lohn- und Personalausgleich (vgl. hierzu Riexinger/Becker 2017). Dies wäre eine Forderung, auf die sich der überarbeitete IT-Spezialist mit der Minijobberin an der Supermarktkasse einigen könnte. Sie würde Arbeitende zusammenbringen, die sonst wenig verbindet, würde gemeinsame Interessen von Beschäftigten in den Vordergrund stellen, anstatt »Arbeitszeiten, die zum Leben passen« weiterhin als Privileg der Jungen und gut Qualifizierten zu behandeln. Damit würde der Logik einer Arbeitswelt, die auf dem Kampf aller gegen alle beruht und in der dieser Kampf nicht zuletzt in der Währung »Zeit« geführt wird, eine humanere und solidarische Alternative entgegengesetzt. Arbeitszeitverkürzung in diesem Sinne würde sicher zum Gegenstand harter Auseinandersetzungen werden – und in diesen Auseinandersetzungen hätte man es vielleicht auch mit einem Generationeneffekt zu tun. Immerhin müssten sie von Beschäftigten geführt werden, die zwischen Mitte der 1980er Jahre und heute erwerbstätig geworden sind. Sie könnte man als »Generation Sachzwang« bezeichnen: als diejenigen, denen Unternehmen und Politik weisgemacht haben, es gäbe keine Alternative zu Konkurrenz und Spaltung im Zeichen eines angeblich »freien Marktes«. Doch selbst dann taugt der Verweis auf das historische Schicksal, in dieser (langen) Periode erwerbstätig geworden zu sein, nicht als Ausrede für Untätigkeit. Denn der Kampf um Arbeitszeitverkürzung als gesellschaftspolitisches Projekt könnte dazu beitragen, die Konkurrenz zwischen Jungen und Alten, Männern und Frauen, mehr oder weniger Qualifizierten zu reduzieren, und daran erinnern, dass eine andere, humanere Arbeitswelt möglich ist.