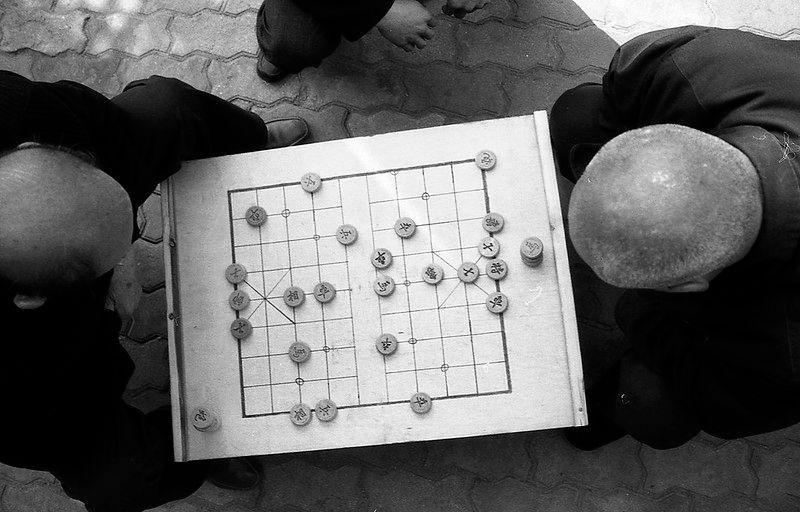Was ist an einer Positionierung zu China aus linker Perspektive denn so dringend?
INGAR: Dafür gibt es aus meiner Sicht vor allem drei Gründe: Erstens steht China zunehmend im Fokus westlicher Aggressionen. Tatsächlich wird der Konflikt zwischen den USA und China das 21. Jahrhundert konfigurieren und tut es schon jetzt. Zweitens zielen die Angriffe im Besonderen darauf, eine bestimmte Form des Staatsinterventionismus zurückzudrängen. Chinas Wirtschaftspolitik wird von den USA und der EU als »illegaler Staatssubventionismus« eines »systemischen Rivalen« gebrandmarkt. Und drittens: Während man in der EU beim Kampf gegen die drohende Klimakatastrophe bis hinein ins linke Bürgertum vornehmlich auf einen »technologischen Optimismus« und neoliberale Marktlösungen setzt, ist China dem Westen in vielerlei Hinsicht überlegen. Die Voraussetzung für Chinas Führungsrolle im Bereich Hochgeschwindigkeitszüge, E-Mobilität (insbesondere im öffentlichen Nahverkehr) oder erneuerbare Energien, für seinen durchaus widersprüchlichen Weg in Richtung ›Öko-Zivilisation‹, ist die Nutzung seiner enormen Staatsressourcen. Der Westen steht also vor dem Scheideweg. Er muss sich überlegen, ob er Chinas Weg bekämpfen oder nachahmen will. Die Auseinandersetzung mit China als Macht im internationalen System ist nicht zuletzt für die Suche der Linken nach Auswegen aus der allgegenwärtigen Demokratie-, Gesellschafts- und Klimakrise von entscheidender strategischer Bedeutung.
JAN: Ich stimme voll zu: Die Linke muss ihr Verhältnis zu China unbedingt klären. Das Land ist in den letzten Jahrzehnten ins Zentrum der Weltwirtschaft gerückt. Von daher befinden wir uns gegenwärtig in einer historischen Umbruchsituation. Räumliche Hierarchisierungen und Abhängigkeitsbeziehungen zwischen den einzelnen Zonen des kapitalistischen Weltsystems und folglich Machtressourcen werden grundlegend neu geordnet. Natürlich ist dies hochgradig konfliktär und umkämpft, wird doch zum ersten Mal seit Generationen die globale ökonomische, militärische und politische Dominanz des Westens ernsthaft herausgefordert. Da ist es nicht hilfreich, das Verhältnis zu China primär über einen linken Moralismus zu bestimmen. Natürlich gibt es in dem Land eine Vielzahl von Krisen und sozialen Ungerechtigkeiten, Ausbeutung, ökologische Zerstörung etc. Die Linke aber muss ihr Verhältnis zu China analytisch bestimmen und Widersprüche vor dem Hintergrund der Weltgeschichte und den Machtverhältnissen ihrer Zeit verstehen. Es geht um die Frage, welche Entwicklungsoptionen sozialistische Staaten in einem kapitalistischen Weltmarkt haben. Die Selbsteinbettung Chinas in die kapitalistische Globalisierung ermöglichte es dem Land einerseits, bestimmte Modernisierungsstufen zu überspringen, da es technologische und soziale Innovationen nicht selbst hervorbringen musste. 1,3 Milliarden Menschen wurden aus extremer Armut in Lebensverhältnisse gehoben, die zumindest für mehrere Hundert Millionen von ihnen Bedingungen schufen, die denen im Westen ziemlich nahekommen. Andererseits erzeugte die globalkapitalistische Entwicklungslogik neue Widersprüche, die die des isolierten Aufbaus des Sozialismus ersetzten.
Ist also ein »linker Moralismus« das Hauptproblem in der Diskussion?
DANIEL: Es ist zu einfach, die linke Kritik am chinesischen Entwicklungsmodell und den Macht- und Herrschaftsverhältnissen als Moralismus zu diskreditieren. Allein in Deutschland gibt es zahlreiche Wissenschaftler*innen und aktivistische Zusammenhänge, die Chinas Entwicklung aus einer historisch-materialistischen Perspektive betrachten. Diese anno 2020 als autoritäre Form des Staatskapitalismus zu begreifen, hat nichts mit Moralismus zu tun, sondern bedeutet, die historischen Voraussetzungen, das institutionelle und ideologische Erbe der Mao-Ära und die durch den kapitalistischen Weltmarkt vermittelten Zwänge in die Analyse miteinzubeziehen. Die Diskussion zur Frage »Ist China sozialistisch oder kapitalistisch oder irgendetwas dazwischen?« muss historisch und empirisch geführt werden. Ansonsten sagen derartige Debatten erfahrungsgemäß mehr über die politische Sozialisation der Beteiligten aus als über den eigentlichen Untersuchungsgegenstand.
Mir scheinen zwei Aufgaben wesentlich: Erstens ist eine historische Analyse der Transformation der Produktions- und Klassenverhältnisse sowie ihrer Einschreibung in die Politik des ja keineswegs monolithischen chinesischen Parteistaats vonnöten. Wie artikulieren sich transnationale Kapitalinteressen mit denen unterschiedlicher Kapitalfraktionen und Teilen der Bürokratie? Wie haben sich Machtverhältnisse und Herrschaftstechniken unter Xi verändert? Wir müssen über das »pro Staatsinterventionismus« oder »pro strategische, gesteuerte Entwicklung« hinausgehen und uns fragen: Welche konkrete Rolle nehmen Interventionen angesichts weitreichender Privatisierung von Industrie, Gesundheitswesen, Wohnungsmarkt in den 1990ern ein? Mit welchen Zielsetzungen agieren unterschiedliche Ebenen und Fraktionen innerhalb von Staat und Partei in den einzelnen Politikbereichen, welche Interessen werden berücksichtigt und welche nicht?
Zweitens müssen wir stärker an die vielfältigen sozialen Kämpfe in China anknüpfen. Es bedarf hierfür Räume des internationalen Austausches. Sie würden auch zeigen, dass die Repression unter Xi massiv zugenommen hat und auch kritische Forschung enorm eingeschränkt wurde – allein in den letzten zwei Jahren wurden Hunderte Arbeiter*innen, Aktivist*innen und Studierende in Polizeigewahrsam genommen. Nur über den Austausch mit kritischen Kräften dort können wir eine solidarische Haltung entwickeln, die sich nicht zwischen den Machtblöcken China, USA und EU aufreiben lässt.
JAN: Mir geht es nicht darum, alle kritischen Einschätzungen zu China mit einem pauschalen Moralismusvorwurf abzutun. Die linke Debatte ist aber oft zu stark von einem Richtig-falsch-Raster geprägt, das eine strategische Positionsbestimmung in einem vermachteten Weltsystem voller Widersprüche erschwert.
Die Diskussion »Ist China sozialistisch oder kapitalistisch oder irgendetwas dazwischen?« endet tatsächlich oft in einer Sackgasse. Chinas Entwicklungsmodell steht nämlich in vielerlei Hinsicht quer zu gängigen Vorstellungen. Es ist richtig, dass Partei und Parteienstaat nicht monolithisch sind, unterschiedliche Interessen auf diversen Ebenen um Macht ringen, nationale und internationale Kapitalfraktionen versuchen, sich Ressourcen zu sichern, und vielfältige soziale Kämpfe ausgefochten werden. Die ökonomische Entwicklung Chinas seit der »Reform- und Öffnungspolitik« ist ja deshalb keine gerade Linie vom »Staat zu immer mehr Markt«, sondern ein Zickzackkurs mit unterschiedlichen Phasen von Experimenten und Korrekturen, ein Vor und Zurück, weil immer unterschiedliche Interessen und Gruppen über die Richtung gestritten haben. Hatte die Demontage der alten Kommandowirtschaft und die Aufgabe des »Danwei«-Sozialsystems in den 1990er Jahren1 unter Staatspräsident Jiang Zemin eine klare neoliberale Ausrichtung, ging es bereits in den 2000er Jahren unter der Führung von Hu Jintao darum, die extremen Auswüchse der Privatisierung und Liberalisierung über den Ausbau nationaler Sozialsysteme und Arbeitsmarktregulierungen wieder einzufangen. Auch heute streiten Fraktionen für mehr Privatisierung, während andere staatseigene Betriebe und kommunale Kollektive stärken wollen. Es gibt sogar Interessengruppen in der Partei, denen der aktuelle Handelskrieg nicht ungelegen kommt, weil so eine Öffnung und Liberalisierung des Finanzsystems möglich erscheinen, etwas, was sie allein politisch nie hätten durchsetzen können. Kurzum: In Chinas Entwicklungsmodell finden wir kapitalistische und sozialistische Elemente und Interessen und ob sich China mehr in Richtung Sozialismus oder Kapitalismus entwickeln wird, ist noch offen.