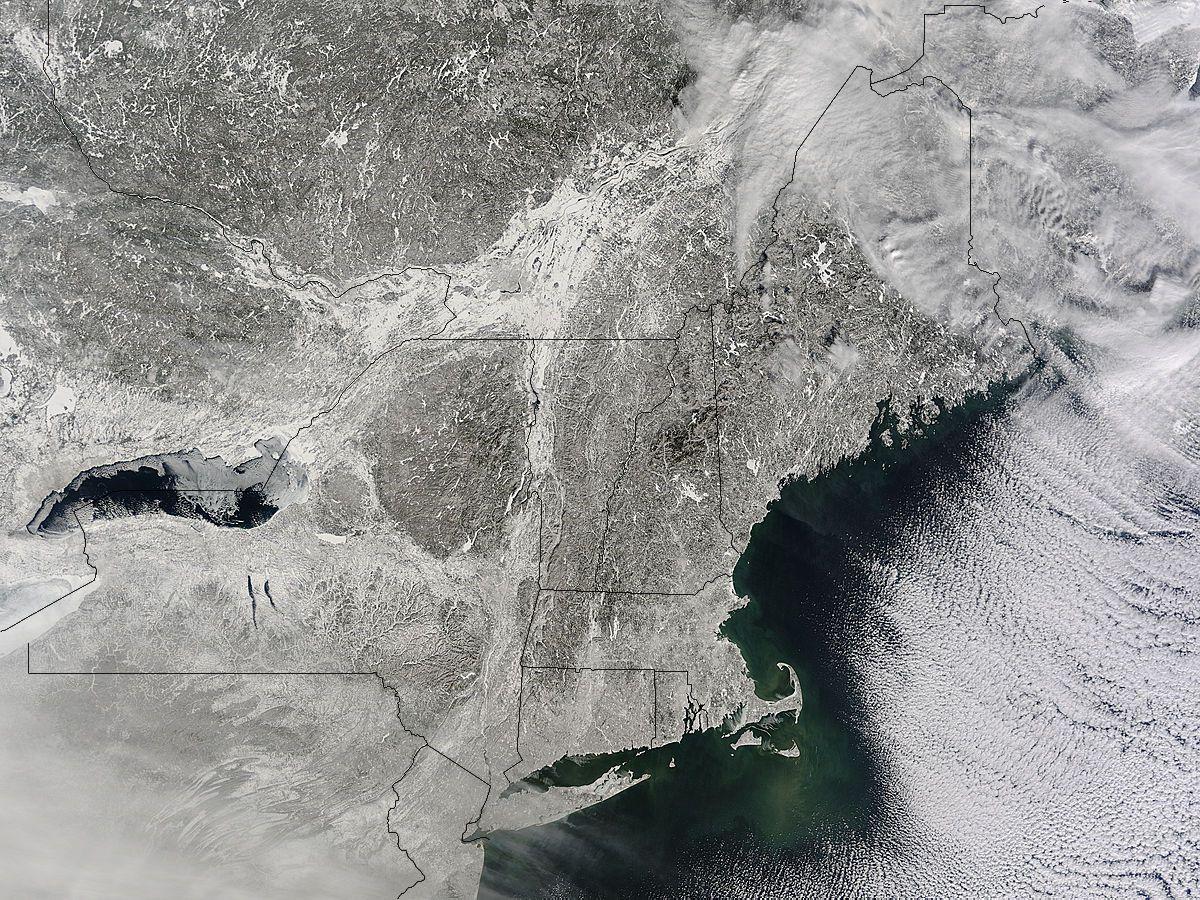Reorganisation statt decline
Eine seit über 40 Jahren beispielsweise von Weltsystemtheoretikern wie Immanuel Wallerstein und Giovanni Arrighi vertretene These besagt, die USA befände sich auf dem weltpolitischen Rückzug und im generellen Niedergang. Nach den Kriegsdesastern von Irak bis Afghanistan sei Obama im Kern ein Decline-Manager. Gerade im medialen und politischen Dauerfeuer rund um eine wachsende deutsche Macht und ›Verantwortung‹ wird dies gern so dargestellt. Wieso also von einer neuen aggressiven US-Geopolitik sprechen?
1 | Zweifellos fordern die USA von Deutschland und der EU ›mehr Verantwortung‹ für das Management des globalen Kapitalismus und seiner Widersprüche ein. Dabei geht es allerdings um eine neue Verteilung von Aufgaben innerhalb des Empire, dessen Teil Deutschland und die EU nun einmal sind. Die strategische Neuausrichtung der US-Außenpolitik sollte nicht mit Rückzug verwechselt werden. Dies wäre auch possierlich angesichts der Tatsache, dass unter der Obama-Regierung (Drohnen-)Kriege in acht Ländern geführt wurden – Irak, Afghanistan, Pakistan, Libyen, Syrien, Jemen, Somalia, Mali – und verdeckte Operationen in unzähligen weiteren.
2 | In der auf die Entwicklung und Integration des globalen Kapitalismus zielenden Politik des Empire gibt es eine Kontinuität der Ziele bei relativer Diskontinuität der Mittel. Nach dem Scheitern der neokonservativen Bodentruppen-Nation-Building-Strategie unter George W. Bush führt die Neuausrichtung der Mittel zurück zu einer klassischen Außenpolitik im Stil von Mahan und Brzezinski.1 Die imperiale Integration des globalen Kapitalismus soll wieder mithilfe einer Kontrolle der Weltmeere durch eine US-Militär- und Handelsflotte sowie Brückenköpfe gesichert werden; und zwar mittels kapitalistischer Durchdringung durch Handelsverträge sowie Militärbündnisse und -basen. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Dominanz der eurasischen Landmasse.
3 | Die Innen-Außen-Dialektik der USA und des American Empire, was nicht das Gleiche ist, heißt aber auch: Voraussetzung für nationale Wachstums- und Wettbewerbsstrategien ist die Verbesserung der Exportmöglichkeiten über Freihandelsabkommen. Diese sind mit dem Scheitern der Doha-Runde zur Welthandelsliberalisierung dem gesamtamerikanischen Freihandelsabkommens FTAA sowie den Problemen der asiatisch-pazifischen Freihandelszone jedoch ins Kriseln geraten. An die Stelle einer multilateralen Vorgehensweise wurden bilaterale Pakte gesetzt, doch auch diese wackeln, weil weltweit der Widerstand wächst. Unter Obama kamen lediglich bilaterale Verträge mit Kolumbien, Panama und mit Südkorea zustande. Vor diesem Hintergrund drängt Obama in Fragen der Trans-Pacific Partnership (TPP) und TTIP auf autoritäre Maßnahmen und eine Rückkehr zur Trade Promotion Authority Bushs. Diese erlaubte es dem Präsidenten, Handelsverträge ohne Konsultation des Kongresses abzuschließen. Nicht nur fehlt die Grundlage für die von Obama avisierte Verdopplung der US-Exporte bis 2017, die USA sehen sich außerdem mit einer zunehmenden regionalen Integration sowohl in Lateinamerika (ALBA als linkes Gegenmodell zur FTAA, Mercosur, SUCRE als Mittel gegen schuldenimperialistische IWF- und Weltbank-Praktiken, UNASUR als Baustein für eine gemeinsame Außenpolitik) als auch in Ostasien (Shanghai Cooperation Organization, Asia Cooperation Dialogue, Chiang-Mai-Pakt) konfrontiert.
Empire-Aussen
Die regionale Integration in Asien könnte für die USA und die mit ihnen verbündeten kernkapitalistischen Staaten zum Problem werden: Zentrale geostrategische Herausforderung ist die subordinierte Einbindung Chinas in die neoliberale Weltwirtschaftsordnung. Die Selbsterklärung zur »pazifischen Macht« unter Obama ist in diesem Kontext zu betrachten. China ist als Teil von »Chimerika« (Niall Ferguson) weiterhin in einer abhängigen Position von den USA (und umgekehrt); wie es sich zukünftig ausrichten wird, ist allerdings offen. Deng Xiaopings Reformen ab 1978 und Chinas WTO-Beitritt 2001 als lineare Entwicklung hin zur Marktöffnung zu begreifen, geht an den Tatsachen vorbei. Kapitalistische Durchdringung und imperiale Unterordnung grenzen an zwei verbliebene Bastionen des ›Sozialismus chinesischer Prägung‹: erstens die vom Westen vehement eingeforderte Liberalisierung des binnenchinesischen Finanzmarktes und zweitens die nicht weniger vehement geforderte Privatisierung des kollektiven Landbesitzes. Trotz Willensbekundungen von chinesischer Seite hat sich hier bislang wenig getan. Für die imperiale Einbindung Chinas gibt es keine historischen Vorbilder. Mit Deutschland und Japan integrierten die USA nach 1945 zwar ökonomisch zentrale, aber vergleichsweise kleine Staaten. Die Bevölkerung Chinas ist dagegen mehr als viermal so groß als die eigene. Deutschland und Japan waren außerdem militärisch besiegt und von den USA besetzt, ihre herrschenden Klassen befürchteten eine wirtschaftliche Entmachtung. China dagegen ist ein souveräner Staat, und obwohl bis vor Kurzem noch ›Entwicklungsland‹, kehrt es nicht zuletzt durch eine kluge Außenwirtschaftsdiplomatie wieder zu alter Stärke zurück. Schließlich wurden Deutschland und Japan unter den Bedingungen der Bipolarität in das Empire integriert, zu einem Zeitpunkt, als die USA über die Hälfte des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) verfügten. Inzwischen kommen sie auf weniger als ein Viertel des globalen BIP, womit die Integrationskapazitäten ausgerechnet zu einem Zeitpunkt schrumpfen, da sie angesichts der Multipolarität nach dem Ende des Kalten Krieges dringend vonnöten wären.
Integration durch Containment
Die China-Politik der USA nimmt immer mehr die Form einer Strategie der Einbindung durch Eindämmung an. Die USA machen sich erfolgreich Spannungen um Territorien im Südchinesischen Meer zunutze, um als regionale Ordnungsmacht auftreten zu können. Unter Obama wurden zahlreiche bilaterale Militärbündnisse mit Australien, den Philippinen, Japan, sogar mit Vietnam und Indien aus- und aufgebaut. Die Konflikte vor Ort werden genutzt, um regionale Integrationsbemühungen zu hintertreiben und die Festigung konkurrierender Blöcke außerhalb des American Empire zu verhindern. Um beispielsweise abzuwenden, dass China mithilfe des Chiang-Mai-Abkommens, einem ostasiatischen Währungssystems jenseits des Dollars, die US-Finanzhegemonie herausfordert, wird ein klassischer, geopolitischer Hebel genutzt: die Drohung mit einer maritimen Kontinentalsperre. Die außenpolitischen Eliten der USA vertrauen darauf, dass Chinas Staatsführung keine Konfrontation sucht, denn fast 80 Prozent des chinesischen Außenhandels und der überlebenswichtigen Rohstoffimporte werden über das von den USA kontrollierte Südchinesische Meer abgewickelt. Sie können also im Grunde damit drohen, soziale Revolten in China auszulösen, denn aus Gründen der innenpolitischen Stabilität ist die chinesische Regierung auf anhaltend hohe Wachstumsraten von um die 7 bis 9 Prozent angewiesen, um die rund 250 Millionen Wanderarbeiter sozial integrieren zu können. Sinkendes Wachstum bliebe nicht ohne Folgen für den Machtanspruch der Kommunistischen Partei. Nicht nur gegenüber China, sondern auch gegenüber Lateinamerika verfolgen die USA immer deutlicher eine Politik des containment. Die Pazifik-Allianz soll nach dem Scheitern der FTAA die starken regionalen Integrationsprozesse im linksgewendeten Lateinamerika hintertreiben. Die dritte Eindämmungsstrategie bezieht sich auf Russland. Die Anzeichen verdichten sich, dass die USA gegen Russlands subimperiale Eurasienpläne (Shanghai Cooperation Organization, Eurasische Wirtschaftsunion) mittlerweile auf Eindämmung durch Konflikt drängen. Diese Strategie wird dabei unmittelbar in Beziehung gesetzt zur Kennan’schen Außenpolitik nach 1947 und als »Containment 2.0« diskutiert.2 Ökonomisch sind die USA – im Gegensatz zur EU – kaum mit Russland verflochten. Insofern können sie innenpolitische und regionale Konflikte um die Ukraine nutzen und als Ordnungsmacht auftreten. Mit dieser Politik durchkreuzen sie Strategien des deutschen und europäischen, von russischen Energieimporten abhängigen Kapitals (Deutsch-russische Auslandshandelskammer, Geneva Ukraine Initiative), die auf ›Wandel durch Handel‹ zielen. Der European Council on Foreign Relations propagiert einen Spagat: »Soft Containment«, militärisch-politische Konfrontation Russlands bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung ökonomischer Integration. Dagegen könnte eine Einhegung, die auf Rückentwicklung ökonomischer Verflechtung zwischen Russland und der EU hinausläuft, im Rahmen der neuen US-Wachstumsstrategie zugleich Europa als Markt für US-Energieund besonders Fracking-Technologieexporte erschließen (vgl. Daniljuk in diesem Heft). Das American Empire zieht seine Stärke dabei auch aus sinkenden Energiepreisen. Diese schwächen die Ausgangspositionen sowohl Russlands als auch der auf Ausbeutung von Rohstoffen angewiesenen lateinamerikanischen Staaten.
Gewalt 1: Nicht-Krieg
Das Hauptziel der Politik der kapitalistischen Kernstaaten ist ein neoliberaler globaler Kapitalismus. Mittel zu diesem Zweck sind Wirtschafts- und Handelsverträge. Sie gewährleisten die Durchdringung nationaler Gesellschaftsformationen und schützen die transnationalen Konzerne vor den Auswirkungen der Demokratie. Die Politik der »Penetration« (Peter Gowan) geschieht in den seltensten Fällen auf dem Kriegsweg. Die nichtmilitärische Gewalt des Schuldenimperialismus besteht darin, dass eine Marktöffnung zu den Bedingungen der kapitalistischen Kernstaaten erzwungen wird, und zwar auf dem Wege der Staatsverschuldung und der entsprechenden Auflagen, die vermittels IWF und Weltbank an westliche Kredite geknüpft sind. Eine Ausnahme bilden jene Länder, die aufgrund ihrer geringen Außenhandels- und Staatsschulden nicht auf diesem Weg zur Integration in die neoliberale Weltwirtschaft gezwungen werden können. Dies gilt insbesondere für die ölexportierenden Länder – historisch wurden sie teilweise durch direkte militärische Gewalt aufgebrochen. Dass der neue Imperialismus seine ökonomischen Ziele meist auf einem nichtkriegerischen Weg erreicht, macht ihn nicht weniger gewaltförmig. Die Kunst besteht darin, wie Bertolt Brecht in Me-ti. Buch der Wendungen anmerkt, die »Gewalt zu erkennen«; diese nimmt im Kapitalismus im Normalfall die Form der indirekten, strukturellen Gewalt an. Dies gilt sowohl im Innern für den Markt als Zwang (zum Verkauf der Ware Arbeitskraft) als auch nach außen für die Wirksamkeit der Herrschaft über ungleiche Entwicklung und Tauschverhältnisse, die schuldenimperialistische Praktiken ermöglichen.
Gewalt 2: Krieg
Warum dann überhaupt Kriege? Physische Gewalt ist trotz allem nicht verschwunden, im Gegenteil, seit den 1980er Jahren nehmen zivilgesellschaftliche und staatliche Gewalt zu. Unter Obama änderte sich entsprechend auch die strategische Ausrichtung des Militärs: Kapazitäten werden geschaffen, um zwei oder mehrere Kriege gleichzeitig führen zu können. Die Ursache für viele der neuen Kriege des ›Westens‹ sind die selbst produzierten Widersprüche des globalen Kapitalismus: Der Freihandelsimperialismus hat mit jedem neuen Abkommen im Interesse hochsubventionierter US- und EU-Agrarkonzerne ganze Länder und ihre Bevölkerungen umgepflügt, Hunderte Millionen früherer Subsistenzbauern enteignet und ein riesiges neues globales Proletariat geschaffen (vgl. Wulf in diesem Heft). In einer neuen Welle weltweiter Massenmigration sammelt es sich in den Megametropolen des globalen Südens wie Lagos oder Dhaka. Kapitalistische Normalarbeitsverhältnisse finden sich hier kaum. Zugleich hat die strukturelle Macht des Kapitals, das heißt seine Mobilität, im Zuge dieser Politik zu einem verheerenden Standortkrieg einer wachsenden Zahl an Nationalstaaten geführt. Faktisch konkurrieren sogar Regionen und Kommunen mit niedrigen Steuersätzen und Subventionen um (ausländische Direkt-)Investitionen. Die Nationalstaaten geraten unter Druck, und die schwächsten unter ihnen zerbrechen. Teile der repressiven Staatsapparate machen sich selbständig; die Durchsetzung des Gewaltmonopols wird zunehmend schwieriger, weil lokale Milizen die militärische Okkupation und den Ausverkauf von nationalen Ressourcen (Ölfelder, Gold-, Silber- und Diamantenminen etc.) in die eigene Hand nehmen oder innerstaatliche Verteilungskämpfe, Entsolidarisierung und Sezessionstendenzen reicherer Regionen befördern, die oft in (ethnisch, religiös und anders überformte) Bürgerkriege ausarten. Die Folge von knapp 40 Jahren neoliberaler Freihandelspolitik, daraus resultierendem Staatszerfall und ›neuen Kriegen‹ ist, dass sich die globale Migration nicht nur in LandStadt-Richtung, sondern auch in Süd-NordRichtung vollzieht. Historisch vergleichsweise kleinere Konflikte haben heute ungleich dramatischere Auswirkungen im Hinblick auf Landvertreibung und Migration (vgl. Georgi in diesem Heft). In der Krise hat sich diese Dynamik verschärft. Sie vernichtete weltweit 50 Millionen Arbeitsplätze. Nach Schätzungen des früheren IWF-Chefs Dominique Strauss-Kahn müssten allein in Nordafrika und im Nahen Osten 80 Millionen Arbeitsplätze geschaffen werden, um die soziale Konfliktlage, die zur Arabellion führte, zu entschärfen. Gruppen wie der Islamische Staat (IS) machen sich dies zunutze. Während sie aus dem Westen vor allem Teile der arabischstämmigen Arbeiterklassejugend anziehen, die sich angesichts ihrer Perspektivlosigkeit dem Salafismus zugewandt haben, ist der IS für ägyptische Ingenieure und andere regionale Professionals eher ›Arbeitgeber‹. Er bietet ökonomische Perspektiven ähnlich der Drogenkartelle in Mexiko und Zentralamerika (die sich seit den Freihandelsabkommen NAFTA 1994 und CAFTA 2005 rapide verbreiteten). Ein zentraler Aspekt des neuen Imperialismus sind deshalb Kriege der westlichen Staaten, die auf den Bumerang der eigenen freihandelsimperialistischen Politik und das durch vorherige Kriege (vom Irak bis Libyen) selbstproduzierte Chaos reagieren. Die USA – begriffen als »Prototyp eines Globalstaates« (Leo Panitch) – bearbeitet diese Widersprüche auf Weltebene. Dabei sind sie zunehmend auf die anderen Staaten des American Empire angewiesen, weil die zentripetale Wirkung des bipolaren Systems nicht mehr vorhanden, zugleich aber seine ökonomische Macht als Grundlage der politisch-militärischen Machtkapazitäten seit den späten 1960er Jahren zurückgegangen ist. Dagegen hat das Ausmaß der kapitalistischen Verheerungen fürchterlich zugenommen. Entsprechend wachsen die Herausforderungen für das Empire in einem Augenblick, in dem seine Ressourcen im Umgang mit den Widersprüchen schwinden. Die dreifache Eindämmungspolitik ist somit auch ein Ausdruck der Schwäche. Schwäche mit Rückzug zu verwechseln wäre jedoch fatal.