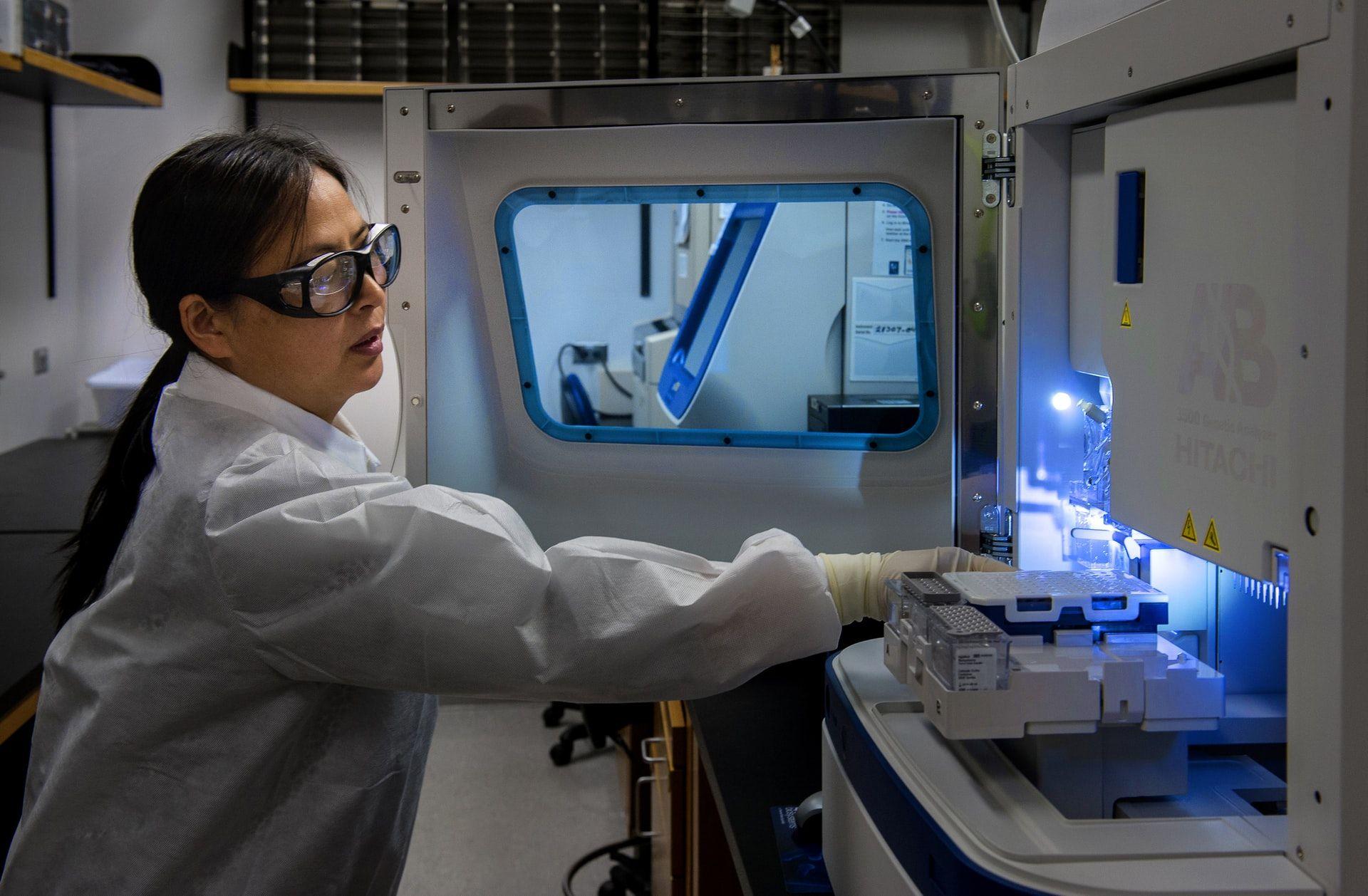»Noch nie haben Pharma-Unternehmen und Forschungseinrichtungen so schnell auf einen neuen Erreger reagiert wie auf das neue Coronavirus SARS-CoV-2, das die Krankheit COVID-19 hervorruft«, lobt sich der von dem Unternehmen Bayer ins Leben gerufene Verband der forschenden Arzneimittel-Hersteller (VFA) mit Verweis auf die vielen Bemühungen zur Entdeckung von Impfstoffen und Arzneien selbst.[1] »Reagiert« – das trifft es. Proaktive Unternehmungen stehen nämlich nicht zu Buche. Dabei sah das nach dem Auftreten des ersten SARS -Erregers im Jahr 2002 noch ganz anders aus.
Damals brach in Labors ähnlich wie jetzt eine hektische Betriebsamkeit aus. 14 Firmen – von den Großen beteiligte sich nur Pfizer – forschten an Gegenmitteln, wie die Fachzeitschrift Pharmaceutical & Diagnostic Innovation 2003 berichtete.[2] Nur hielten sie nicht lange durch. Nachdem sich die erste Aufregung gelegt hatte, stellten die meisten Betriebe ihre Aktivitäten wieder ein. Spätestens als es galt, mit einem Wirkstoff-Kandidaten in die klinischen Prüfungen zu gehen, scheuten sie die fälligen Investitionen. Aus dem gleichen Grund stiegen die Konzerne auch nicht in staatliche Projekte ein. Peter Hotez vom Zentrum für Impfstoff-Entwicklung am Kinderkrankenhaus von Houston etwa scheiterte daran, Finanziers für Tests mit einem Vakzin gegen SARS 1 zu finden. »Wir haben wirklich alles versucht, um Investoren zu gewinnen und Zuschüsse zu bekommen, damit wir unsere Arbeit in der Klinik fortsetzen konnten. Aber wir stießen einfach auf zu wenig Interesse«, beklagt er sich.[3] Der Appell der damaligen Direktorin der Weltgesundheitsorganisation WHO, Gro Harlem Brundtland, die Arzneientwicklung weiterzutreiben, verhallte ungehört. Brundtland hatte 2003 nach der Eindämmung der Pandemie vor einer Rückkehr des Erregers gewarnt, deshalb eine Stärkung der öffentlichen Gesundheitssysteme angemahnt und gefordert: »Die SARS-Forschung muss weitergehen.«[4] Die Industrie aber wandte sich lieber lukrativeren Projekten zu. So gibt es bis heute keinen Impfstoff gegen SARS-1, kein Medikament gegen die damit einhergehende Lungenkrankheit – und keine Grundlagenarbeit, die die Mediziner*innen in Sachen SARS-CoV-2 hätten nutzen können. »Hätten wir einen Impfstoff gegen SARS entwickelt, könnten wir heute Covid-19 vielleicht besser verstehen und bald schon behandeln«, macht Francesca Colombo [im März 2020, Anm. d.Red.] von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) deutlich.[5]
Keine Epidemie-Forschung
Mittel für Epidemien zu entwickeln, die vielleicht alle 10, 15 Jahre mal ausbrechen, vielleicht aber auch nicht, bietet Bayer & Co. kaum Aussicht auf verlässliche Renditen. »Vorsorge ist ein lausiges Geschäftsmodell, wenn es um steigende Margen und Aktienkurse geht«, konstatierten Jürgen Kaube und Joachim Müller-Jung in der FAZ.[6] Der Novartis-Chef Vasant Narasimhan räumte die Schwierigkeiten der Branche mit solchen Phänomen wie Corona denn auch freimütig ein. »Epidemiologische Kontrolle« sei das Gebot der Stunde, auf einen Impfstoff gelte es noch mindestens ein Jahr zu warten, sagte er in einem Interview Ende Januar [2020].[7] Auf die anschließende Frage der Journalistin, ob die Industrie angesichts der Seuchen der letzten Zeit wie SARS-1, der Vogel- oder der Schweinegrippe nicht einmal etwas anderes tun sollte, als nur zu reagieren, nämlich zu versuchen, dem Virus zuvorzukommen, gab er eine klare Antwort. »Wenn diese Epidemien auftreten, gibt es sehr viel Interesse […], aber danach verliert sich das Interesse wieder, und die Investoren ziehen sich zurück«, so erklärte Narasimhan in der TV-Sendung die Untätigkeit von Big Pharma auf diesem Sektor. Diese dokumentiert auch der Access to Medicine Index. Die jüngste Ausgabe, die im November 2018 herauskam[8], verzeichnete bei den 20 größten Arznei-Unternehmen kein einziges Forschungsprojekt zu den bekannten Coronaviren MERS und SARS-1. Dementsprechend unterfinanziert sind die Anstrengungen der Infektiolog*innen. Dem australischen Thinktank »Policy Cures Research« zufolge[9] flossen in den Bereich an Industriegeldern 2016 nicht mehr als 27 Millionen Dollar, 2017 50 Millionen und 2018 36 Millionen. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2019 investierte Bayers Pharma-Sparte – Marketing-Kosten mit eingerechnet – rund 2,7 Milliarden Euro in Forschung & Entwicklung. Über die Jahre haben immer mehr Firmen das Geschäftsfeld »Infektionskrankheiten« abgewickelt. Übrig blieben vier große Player, die 80 Prozent des Marktes beherrschen. Bayer hat das Forschungsgebiet gemeinsam mit »Asthma« und »Urologie« bereits 2004 aufgegeben und die Sparte 2006 an die Santos Holding verkauft. Die Abteilung »Atemwegserkrankungen« schlug der Leverkusener Multi noch früher los. Der Konzern vollzog zu dieser Zeit einen Strategiewechsel. Er wollte sich fortan auf viel Gewinn versprechende »High priority«-Projekte wie etwa Krebs-Therapeutika konzentrieren und nicht länger ein umfassendes Arzneiangebot bereitstellen. Als »Gelübde an den Kapitalmarkt« bezeichnete die Börsen-Zeitung damals die Entscheidung.[10] Aus der Tropenmedizin – lange nur ein Teilgebiet der »Infektionskrankheiten«, inzwischen aber darüber hinausgehend – hatte sich der Global Player bereits 1987/88 verabschiedet. Gerade diese Fachrichtung hätte heute wichtige Erkenntnisse zur Eindämmung der Pandemie beitragen können, handelt es sich bei Malaria, Bilharziose und Chagas doch wie bei COVID-19 um von tierischen Erregern übertragene Infektionskrankheiten, sogenannte Zoonosen. Bayer gelang es hier einst, einige Erfolge zu erzielen. Zunächst gab der Leverkusener Multi pharmakologischen Flankenschutz für die kolonialistischen Bestrebungen des Kaiserreiches – oder wie er selbst es ausdrückt: »[d]ie kulturelle und wirtschaftliche Erschließung der Tropen«[11]. Darum verlieh das Unternehmen seinem 1923 entdeckten Pharmazeutikum gegen die von der Tsetsefliege übertragene Schlafkrankheit auch den patriotischen Namen Germanin. Und noch zwei weitere Tropenarzneien brachte der Pillen-Riese heraus. Er entwickelte das Malaria-Mittel Resochin, dessen Wirkstoff Chloroquin er 1937 zum Patent anmeldete, 33 Jahre später Lampit gegen die Chagas-Krankheit und Mitte der 1970er Jahre schließlich, gemeinsam mit Merck, Biltricide zur Behandlung der Bilharziose. Das war es dann aber auch. Ab einem bestimmten Zeitpunkt verwaltete Bayer nur noch die Bestände, obwohl einzelne Präparate wie etwa Resochin an Wirksamkeit einbüßten. »Ein neues Malaria-Mittel wäre ethisch wünschenswert, aber die Aufwendungen sieht eine Firma nie wieder«, bekundete der Leverkusener Multi. Die Welt am Sonntag veranlasste das zu einem bitteren Kommentar: »Die Pharma-Multis arbeiten nur nach ihren Satzungen – also nicht gegen die Geißeln der Menschheit, sondern für die Dividende. In diesem Umfeld sind Medikamente gegen Malaria und Lepra, Tuberkulose und Bilharziose nur Nischenfüller.«[12]
Kein Wundermittel
Just das Resochin aus der alten Tropenmedizin-Abteilung schien dann kurzzeitig auch vor seinem zweiten Frühling zu stehen. Erste Forschungen mit dem Präparat als Antidot zum ersten SARS-Erreger unternahmen holländische Virolog*innen im Jahr 2004. Chinesische Studien zur Anwendung bei SARS-CoV-2 bescheinigten dem Mittel bei In-vitro-Versuchen »einen gewissen pharmakologischen Effekt«. Ein Test mit 100 Proband*innen fiel ebenfalls positiv aus. Flugs verbreitete der Konzern die frohe Kunde. »Es gibt Hinweise darauf, dass Resochin im Labor und in ersten klinischen Untersuchungen die Virus-Last senkt«, erklärte Bayer-Chef Werner Baumann am 2. April 2020 in einem Handelsblatt-Interview.[13] Und fortan feierte die Aktiengesellschaft sich selber: »Bayer hilft wieder einmal im Kampf gegen die neue Coronavirus-Epidemie, indem es mit großer Geschwindigkeit internationale Hilfe mit Medikamenten leistet.« Als größter Fan von Chloroquin erwies sich US-Präsident Donald Trump. Wahlweise bezeichnete er das Präparat als »Wundermittel«, »Game-Changer« oder »Geschenk Gottes«. Sein noch weiter rechts stehender brasilianischer Kollege Jair Bolsonaro hält ebenfalls große Stücke auf die Pillen. Das blieb nicht ohne Wirkung auf seine evangelikale Anhängerschaft, die ihm vor dem Präsident*innen-Palast ein Ständchen brachte: »Chloroquin, Chloroquin, wir wissen, dass du im Namen von Jesus heilst.« Als »Kokain der Rechtsradikalen« bezeichnete der Journalist Reinaldo Azevedo das Mittel nicht ohne Grund. Diese setzen nämlich immer auf einfache Lösungen, und da sich mit Resochin eine pharmazeutische anbot, griffen sie schnell zu, ehe sie sich den Kopf über Abstände, Hygieneregeln, Verfolgung von Infektionsketten oder gar Shutdowns zerbrechen mussten. Auf die Meinung von Expert*innen hören sie dabei wenig bis gar nicht. Trump enthob den Chloroquin-Skeptiker Rick Bright von seinem Posten als Leiter der BARDA, die innerhalb des Gesundheitsministeriums unter anderem Forschungsprojekte zu SARS-CoV-2 koordiniert. Und der brasilianische Gesundheitsminister Nelson Teich trat aus freien Stücken zurück, weil er einen klaren Kopf behalten wollte, während Bolsonaro, inzwischen selbst an Corona erkrankt, demonstrativ vor laufenden Kameras den Chloroquin-Abkömmling Hydroxychloroquin einnahm. Aber auch in gemäßigteren Kreisen erfreute sich das Pharmazeutikum großer Beliebtheit. So betrieb die Große Koalition Chloroquin-Diplomatie in Pakistan, wo Bayer die Produktion der Arznei wieder hochfuhr. Merkel & Co. setzten sich dafür ein, »dass ein Teil der Bestände zur Ausfuhr nach Deutschland zugelassen wurde«, und nahmen dann dankbar die Spende eines Millionenkontingents entgegen. In den USA drängte Trump derweil auf eine Notfall-Zulassung, obwohl es da schon warnende Stimmen gab. Viele Wissenschaftler*innen äußerten Zweifel an den chinesischen und französischen Chloroquin-Studien, weil diese den wissenschaftlichen Anforderungen kaum entsprachen. Weitere Untersuchungen bestätigten dann ihre Skepsis. Bei einer Erprobung der Substanz in Brasilien starben elf Menschen. Und auch eine Untersuchung der Krankenakten von 368 Patienten eines US-amerikanischen Militärhospitals erbrachte ein beunruhigendes Ergebnis. 28 Prozent der mit dem Chloroquin-Derivat Hydroxychloroquin behandelten Ex-Soldat*innen erlagen COVID-19, während es in der Vergleichsgruppe nur 11 Prozent waren. In der Folge kam es nicht nur zu immer mehr alarmierenden Befunden, sondern auch vermehrt zu Todesfällen durch Selbstmedikation. Vor allem die Nebenwirkung Herz-Rhythmus-Störungen erwies sich als fatal. Die WHO zog schließlich die Konsequenzen und brach ihre Studie ab, während die US-Gesundheitsbehörde FDA ihre Notfallzulassung widerrief. Selbst der Sender Fox News, der vorher eifrig Chloroquin-Propaganda ausgestrahlt hatte, warnte jetzt: »Das Medikament wird Sie töten.«[14] Daraufhin erhielt der Leverkusener Multi sehr viel Kritik für seinen Umgang mit Chloroquin. »Bayer trat dem Hype nicht entgegen, im Gegenteil«, monierten die Journalisten Christian Baars, Florian Flade und Markus Grill.[15] Der ehemalige Vorsitzende der Deutschen Herzstiftung, Thomas Meinertz, stimmte mit ein und bezichtigte den Konzern der Tatenlosigkeit: »Wenn man ein Medikament hat, dann ist man als Hersteller eigentlich verpflichtet zu prüfen, ob es in dieser Indikation wirksam ist oder nicht.«[16] Das taten jedoch andere, und nicht immer ließen sie dabei die gebotene Vorsicht walten. »Der Druck – auch aus der Ärzteschaft – war enorm, unsichere Sachen auszuprobieren«, klagte etwa der Schweizer Infektiologe Hansjacob Furrer.[17] Wolf-Dieter Ludwig von der Arzneimittel-Kommission der Deutschen Ärzteschaft stieß sich vor allem an der vorschnellen Veröffentlichung von Chloroquin-Studien, deren Resultate nachher keinen Bestand hatten. »Das ist absolut typisch für diese Krisen-Situation und für diese Pandemie«, konstatierte Ludwig, der überdies Bayer »massives Marketing« im Zusammenhang mit dem »Wundermittel« vorwarf.[18] So musste es der Global Player im Angesicht von Corona bei milden Gaben belassen. Der Leverkusener Multi spendete Medikamente, Desinfektionsmittel, Schutzausrüstungen, Beatmungs- und Testgeräte. Zudem stellte er Beschäftigte für Corona-Tests ab und verteilte Saatgut und Pestizide an Kleinbauern und -bäuerinnen.
Bill Gates als Ausputzer
Mit pharmazeutischen Vorhaben, die keine Millionenprofite versprechen, befassen sich die Konzerne nur, wenn sie dafür öffentliche Unterstützung erhalten. Und selbst dann nicht immer. Als die EU im Rahmen der Innovative Medicines Initiative (IMI), deren 5,3 Milliarden Euro schweren Etat sie gemeinsam mit den Pillen-Riesen trägt, 2018 ein Projekt starten wollte, das die Mitgliedsländer besser gegen Epidemien wappnen sollte, blockten die Unternehmen ab. »Das war für die Pharma-Industrie finanziell nicht interessant«, konstatiert Marine Ejuryan von der Initiative Global Health Advocates.[19] Felder wie »Autoimmun-Erkrankungen« oder »digitale Gesundheit« erschienen Bayer & Co. da viel lukrativer. Das Geld der von der Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) gegründeten Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) nehmen die Konzerne ebenfalls nicht einfach so. Stattdessen bestanden sie gegenüber der Einrichtung, die auch Zuwendungen der Bundesregierung erhält, auf Profitgarantien und Patentansprüchen. »Ärzte ohne Grenzen« richtete deshalb einen eindringlichen Appell an die CEPI, zu den mit öffentlichen Mitteln geförderten Forschungen auch einen öffentlichen Zugang zu gewähren. Und nicht genug damit, dass die Unternehmen selbst mit leeren Händen dastehen, was SARS-CoV-2 betrifft. Sie scheuen sich nicht einmal, bei der Weiterentwicklung hoffnungsvoller Arznei-Kandidaten ihre Mithilfe zu verweigern, wie das US-amerikanische National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) erfahren musste. Es hatte sich mit der Bitte an die Pharma-Multis gewandt, Fertigungskapazitäten zur Verfügung zu stellen, um das von dem Institut gemeinsam mit dem Unternehmen Moderna kreierte Vakzin für die anstehenden klinischen Tests in ausreichender Menge zu produzieren, erhielt aber nur Absagen. Es ist »sehr frustierend«, gab NIAID-Direktor Anthony Fauci anschließend zu Protokoll.[20] Und wenn die Unternehmen selbst an Impfstoffen arbeiten, brechen sie zu Subventionsshopping-Touren auf und versuchen, die einzelnen Länder gegeneinander auszuspielen. Bevorzugung bei der Belieferung gegen finanzielle Unterstützung – diesen Deal schlagen sie den Regierungen vor. So kündigte Sanofi-Chef Paul Hudson nach erfolgreichen Verhandlungen mit China und den USA schnöde an: »Also werden diese beiden ökonomischen Kraftzentren zuerst geimpft werden«, und erhöhte den Druck auf Brüssel. »[D]aher ist es so wichtig, auch in Europa eine Debatte zu starten unter dem Motto: ›Lasst Europa nicht zurückfallen‹«, befand er.[21] Die Firma Gilead übt diese Praxis der Priorisierung mit ihrer Arznei Remdesivir schon aus. Sie schloss am 29. Juni 2020 einen Exklusivvertrag mit der Trump-Administration und produziert das Pharmazeutikum bis Ende September nahezu ausschließlich für den US-Markt. 520 Dollar pro Dosis soll das Medikament in den Vereinten Staaten kosten, in anderen Industrie-Ländern will Gilead 390 Dollar verlangen. Das »Institute for Clinical and Economic Review« hält demgegenüber lediglich 100 bis 160 Dollar für angemessen. Und selbst das erscheint noch mehr als genug. Das Präparat erfüllte in der klinischen Prüfung nämlich längst nicht alle Erwartungen, die in es gesetzt wurden. Remdesivir schaffte es nicht, die Todesraten zu senken. Deshalb änderten die Wissenschaftler*innen kurzerhand das Studienziel und untersuchten nur noch, ob die Arznei den Genesungsprozess beschleunigen kann. Das gelang ihr schließlich; vier Tage ersparte sie den Patient*innen. »Ein enormer Preis für ein nicht gerade durchschlagskräftiges Präparat«, empörte sich der Republikaner Lloyd Doggett denn auch.[22] Peter Maybarduk von der Verbraucher*innenschutz-Organisation Public Citizen pflichtete ihm bei. »Gilead hat Remdesivir nicht alleine gemacht. Öffentliche Gelder spielten in jedem Stadium der Entwicklung eine entscheidende Rolle […]. Gilead während der Pandemie jetzt zu erlauben, die terms of trade zu setzen, dokumentiert das Führungsversagen der Trump-Administration«, so Maybarduk.[23] Mit solch einer Kritik in Richtung Regierungen und Big Pharma hält sich die Bill & Melinda Gates Foundation hingegen zurück. BMGF-Vorstandschef Mark Suzman konzediert zwar: »Und man kann argumentieren, dass es auf dem Gebiet der Pandemie-Bereitschaft ein massives Marktversagen gibt«, greift die Industrie aber trotzdem nicht direkt an.[24] Er versteht die Foundation ganz diplomatisch als »Brückenbauer« zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor, der die Multis mit Millionen-Zuschüssen dazu verleiten will, nicht nur »in das nächste Viagra« zu investieren. Nur übernimmt die Gates-Stiftung auf diese Weise faktisch die Funktion eines Ausputzers, die mit ihrer Politik dafür sorgt, dass alles so bleiben kann, wie es ist. Es müsste hier aber zu einschneidenden Veränderungen kommen, denn die Dysfunktionalität des Arznei-Business hat sich schon vor Corona erwiesen und zeigt sich nicht nur an seiner Vorliebe für gewinnbringende Lifestyle-Präparate.
Dysfunktionales System
Bayer bietet da ein gutes Beispiel. Die pharmazeutische Grundlagen-Forschung hatte der Konzern schon lange vor der Mitte der 2000er Jahre verkündeten »High priority«-Strategie ad acta gelegt. Und der mit deren Implementierung vollzogenen Kehrtwende fielen längst nicht nur die Antiinfektiva zum Opfer. Auch die Suche nach neuen Antibiotika gab der Pillen-Produzent auf, trotz der immer häufiger auftretenden Resistenzen von Krankheitserregern gegen die alten Mittel. Präparate, die die Menschen nur über einen bestimmten Zeitraum einnehmen dürfen, rechnen sich eben nicht. »Wir müssen Geld verdienen mit unseren Produkten. Das führt dazu, dass nicht alle Medikamente entwickelt werden, die wir brauchen«, mit diesen Worten umriss der ehemalige Vorstandsvorsitzende Marijn Dekkers 2015 in einem Spiegel-Interview einmal die politische Ökonomie des Medikamenten-Geschäfts.[25] Um dieser zu entsprechen, entwickelt der Global Player statt dringend benötigter Mittel jede Menge Pharmazeutika, die niemand braucht. Er schafft es sogar, Krankheiten zu erfinden wie die »Wechseljahre des Mannes«, wenn es gilt, neue Absatz-Märkte zu schaffen. Viagra hat das Unternehmen natürlich auch im Angebot, in der Leverkusener Ausführung heißt es Levitra. Und anstatt sich den großen Menschheitsplagen zu widmen, kapriziert sich die Aktiengesellschaft auf seltene Krankheiten, locken hier doch laxere Zulassungsbedingungen und einträgliche Gewinne. Selbst die zunächst einmal sinnvoll erscheinende Aktivität auf dem Gebiet der Tumorbehandlung erweist sich bei näherer Betrachtung als fragwürdig. So verlängert das Krebsmittel Nexavar das Leben der Patient*innen bloß um rund zwölf Wochen, schlägt aber pro Monat mit über 5.000 Euro zu Buche. Und es geht noch teurer: Das Onkologie-Therapeutikum Vitrakvi kostet in den USA 32.800 Dollar. Zudem betrifft die Dysfunktionalität nicht nur die Produkte, sondern auch die Produktion. Wie andere Hersteller auch, fertigt der Konzern viele Inhalts- oder Grundstoffe für seine Medikamente nicht mehr selber, sondern kauft sie auf dem Weltmarkt ein, vor allem in China und Indien. Diese beiden Länder sind die ersten Glieder der globalen Lieferketten von Big Pharma, allerdings sehr fragile Glieder, weil sich die Fertigung auf immer weniger Anbieter konzentriert. Deshalb kommt es immer wieder zu Lieferengpässen. Auch Bayer-Pharmazeutika fehlten immer wieder in den Apotheken. Unter anderem zählten das die Gehirn-Durchblutung fördernde Produkt Nimotop, das Krebs-Präparat Xofigo, das Herz-Kreislauf-Pharmazeutikum Adalat, der Blutdrucksenker Bayotensin, das Kontrastmittel Ultravist und das zum Beispiel bei der Akut-Behandlung von Herzinfarkten zum Einsatz kommende Aspirin i. v. 500 mg dazu. Insgesamt traten 2019 bei insgesamt ca. 270 Medikamenten Lieferengpässe auf. Im Zeichen von Corona stieg diese Zahl weiter an. »Es war mitunter schwer, an Vorprodukte zu kommen, weil Regierungen den Warenverkehr eingeschränkt hatten«, sagte Werner Baumann in einem FAZ-Interview dazu.[26] Alles in allem unterwerfen die Firmen das Gesundheitssystem knallhart dem Diktat des Profits. Die Kranken haben Glück, wenn sie an einer Krankheit leiden, deren Behandlung Renditen abwirft, wenn nicht, stehen sie auf dem Schlauch. Auch müssen die Patient*innen sich auf Gedeih und Verderb in die Abhängigkeit von den weltweiten Pharma-Lieferketten begeben und bei Lieferengpässen Gesundheitsstörungen oder Schlimmeres riskieren, nur weil die Globalisierung der Produktion sich für Bayer & Co. rechnet. Diese ganzen Missstände führt auch die FAZ in ihrem Artikel »Ein Patient ist kein Kunde« auf[27] und stellt dann die V-Frage, die das British Medical Journal ebenfalls schon aufgeworfen hatte: »Ist es an der Zeit, die Pharma-Industrie zu verstaatlichen?« Die FAZ-Autoren Jürgen Kaube und Joachim Müller-Jung beantworten sie angesichts des offensichtlichen Markt-Versagens durchaus positiv. »Wenn das, was sich als entscheidend erweist, um die Freiheit des öffentlichen und privaten Lebens zu schützen, von Firmen allein nicht bereitgestellt wird, sind – mit einem freundlichen Ausdruck – ›Public Private Partnerships‹ ohne Alternative«, schreiben sie. Unfreundlichere Ausdrücke verwenden und von »Verstaatlichung« oder »Gesundheitssozialismus« sprechen wollen die beiden nicht. Aber sie fordern schon »eine stärkere Intervention in die pharmazeutische Grundsicherung, die nicht einfach dem Gewinn-Kalkül überlassen werden sollte, so als sei dieses Kalkül die mit immer demselben Zitat von Adam Smith belegbare Lösung aller Probleme«. Und tatsächlich unternimmt die Politik Schritte in diese Richtung. So billigte sich die Bundesregierung im Infektionsschutz-Gesetz das Recht zu, bei »epidemischen Lagen von nationaler Tragweite« in das Heiligste von Bayer & Co. einzugreifen, die Patente, sollte sie die Versorgung der Bevölkerung mit dringend benötigten Arzneien anders nicht gewährleisten können. SPD-Fraktionsvize Bärbel Bas forderte bereits, dieses Instrument bei Remdesivir in Anschlag zu bringen, falls es zu keiner Einigung mit Gilead über Lieferungen nach Deutschland käme. In Sachen »Curevac« sicherte die Große Koalition sich diesen Zugriff bereits im Vorhinein. Der Bund erwarb 23 Prozent der Anteile an dem Unternehmen, das an einem Impfstoff gegen COVID-19 arbeitet. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) begründete die Transaktion mit der Notwendigkeit, »elementare Schlüsselindustrien am Standort zu erhalten und zu stärken« und die industrielle Souveränität Deutschlands zu wahren.[28] Vorher hatte es Gerüchte um einen Börsengang der Firma in den USA sowie um das Bemühen Donald Trumps gegeben, Curevac in die USA zu locken. Um es ausländischen Konzernen schwerer zu machen, deutsche Gesellschaften zu übernehmen, senkte Altmaier überdies die Genehmigungspflicht für Beteiligungen. Schon ab einem Erwerb von 10 Prozent der Anteile bedarf es dafür nach der Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes nun der Zustimmung der Bundesregierung. Zudem erkannte sie wegen der zunehmenden Lieferengpässe von Medikamenten Handlungsbedarf. Die Regierung Merkel legte deshalb ein Programm zur Förderung einer inländischen Pharmazeutika-Produktion auf. Und auch auf europäischer Ebene geschieht etwas. In martialischen Worten beschreibt ein Berichtsentwurf des »Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit« über Arznei-Engpässe das Problem.[29] »Der Bereich der öffentlichen Gesundheit hat sich zu einer geostrategischen Waffe entwickelt, mit der ein ganzer Kontinent in die Knie gezwungen werden kann. Unser Souveränitätsverlust offenbart sich im Rahmen dieser Pandemie klar und deutlich«, hieß es in dem Dokument. Darum plädiert die Berichterstatterin Nathalie Colin-Oesteré dafür, steuerliche und andere finanzielle Anreize zu schaffen, um Wirkstoff-Produktionen nach Europa zurückzuholen. Sie geht aber noch weiter und fordert, »pharmazeutische Einrichtungen ohne Erwerbszweck und von allgemeinem Interesse ins Leben zu rufen, die in der Lage sind, bestimmte prioritäre Arzneimittel herzustellen«. Auch schlägt sie der EU-Kommission vor, einen Korb mit Medikamenten zu harmonisierten Preisen vorzuhalten, »um wiederkehrenden Engpässen zu begegnen und sicherzustellen, dass Patienten Zugang zu einer Behandlung haben«. Was bei einigen Beobachter*innen für einen Rotschock sorgt, werten andere schon als Chance für einen »Corona-Sozialismus«. Während Bayer-Chef Baumann zumindest die Globalisierung bedroht sieht, setzen andere Apologet*innen des derzeitigen Wirtschaftssystems derweil auf eine »schöpferische Zerstörung« durch SARS-CoV-2. »Nicht jede Insolvenz ist von Nachteil für die Wirtschaftsstruktur«, befindet etwa Achim Wambach, der Vorsitzende der Monopol-Kommission.[30] Und Christian Kullmann vom Verband der Chemischen Industrie konstatiert:[31] »Die Starken werden stärker werden, die Schwachen schwächer. Das ist das brutale Gesetz der Krise.« Momentan ist es noch zu früh für abschließende Urteile. Eines jedoch dürfte klar sein: Auf die eine oder andere Art wird die Pandemie die Ökonomie verändern.
Dieser Beitrag ist entnommen aus »Die Welt nach Corona«, das bei Bertz + Fischer (© 2021) gerade erschienen ist.