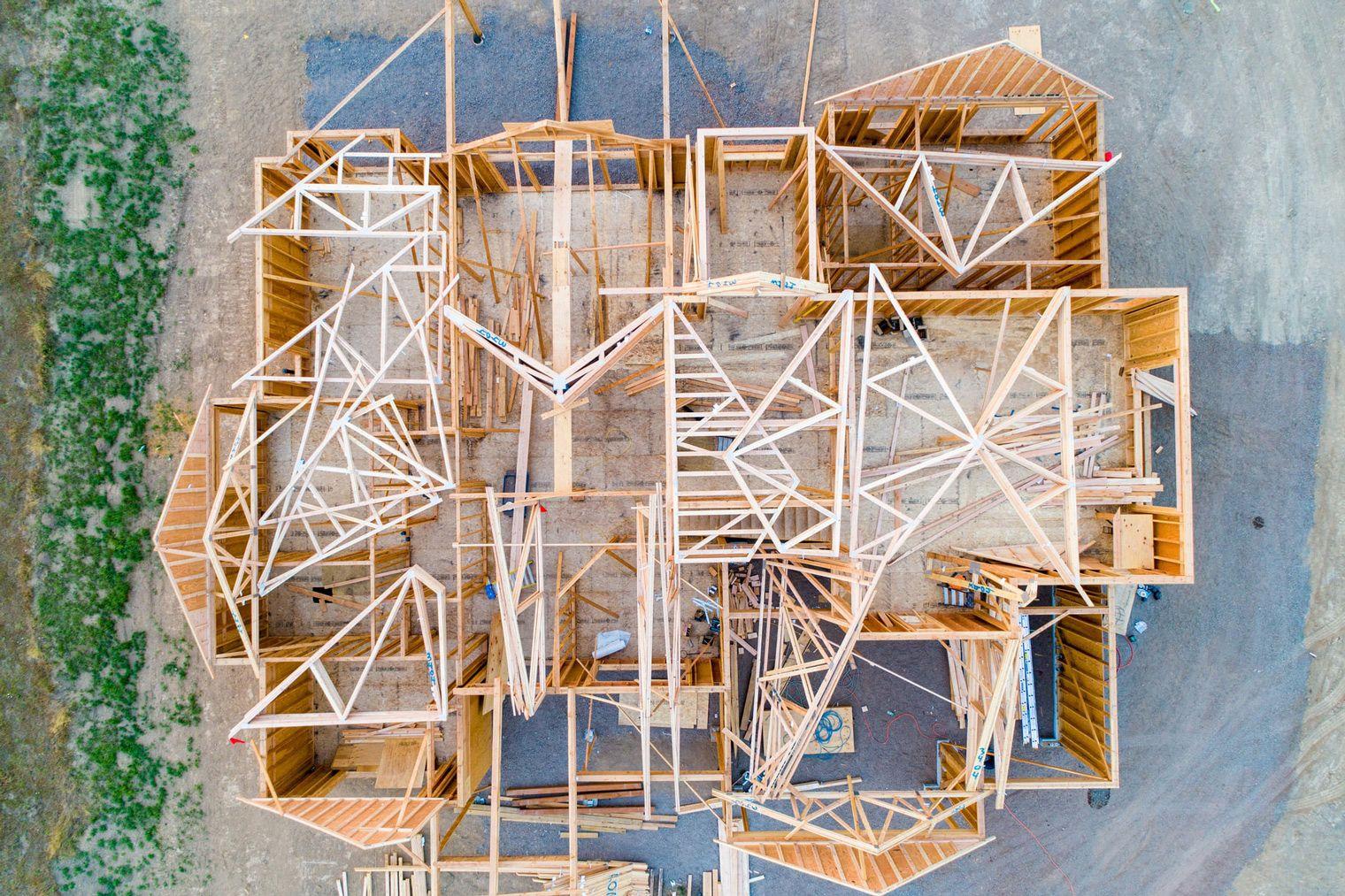»Fabio de Masi bemerkte jüngst irgendwo, DIE LINKE sei »längst eine Mogadischu-Linke, in der unterschiedliche Stammesführer nur noch die eigene schmale Anhängerschaft bedienen«. Er hat vergessen, hinzuzufügen: An diesem Zustand – auch wenn die Bildsprache einige zu Recht kritisieren – tragen viele Repräsentant*innen der Partei Mitschuld. Fabio und mich eingeschlossen.
Darüber hinaus formulierte Fabio: »Eine rationale Linke, die im weitesten Sinne sozialdemokratische Konzepte für Wirtschaft, Umwelt/Energiepolitik und Außenpolitik auf der Höhe der Zeit verkörpert, wäre trotz der öffentlichen Abgesänge und der Krisen des modernen Finanzkapitalismus nötiger denn je«. In dieser Haltung unterstütze ich ihn uneingeschränkt.
Doch während Fabio, wie leider auch eine ganze Reihe kluger Freund*innen von mir, resigniert konstatiert, er habe sich »innerlich bereits so stark von meiner Partei entfremdet, dass mir derzeit der Glaube an dieses Projekt abhandengekommen ist« –, glaube ich weiterhin zuversichtlich an das Projekt einer pluralen linken Partei.
Vielleicht rührt diese Haltung aus meiner Tätigkeit in Thüringen. Seit 2014 arbeiten wir in einer rot-rot-grünen Koalition, die nach fünf Jahren mit einer knappen Ein-Stimmen-Mehrheit, seit 2019 als Minderheitskoalition regiert. Das ist überhaupt nicht einfach. Im Gegenteil. Drei Parteien, die durchaus im Wettbewerb zueinander stehen, bemühen sich auf Augenhöhe ihre Interessen auszugleichen und gesellschaftspolitische Fortschritte zu erreichen.
Wenn das in einer rot-rot-grünen Koalition gelingt – mal besser, mal schlechter –, dann gelingt das auch innerhalb der Partei DIE LINKE. Davon bin ich überzeugt. Doch damit uns dies gelingt, müssen wir die in Einzelinteressen zersplitterte Linke hinter uns lassen.
Auf dem krisenhaften Geraer PDS-Parteitag 2002 gründete ich mit vielen anderen das Forum Zweite Erneuerung. Andere bildeten die Reformlinke, ganz andere den Geraer Sozialistischen Dialog. Seitdem gibt es viele weitere Strömungen: Das Forum Demokratischer Sozialismus (fds), die Sozialistische Linke, Emanzipatorische Linke, die Bewegungslinke, die Antikapitalistische Linke, die Solidarische Linke, die KPF usw. Von außen wirkt es ein wenig wie aus dem Film »Das Leben des Brian«. Einige dieser Strukturen sind heute produktive Stichwortgeber, andere sind faktisch tot – wurden aber noch nicht begraben (darauf verweist das Schlagwort "Mogadischu-Linke").
Die nachfolgenden Überlegungen sollen Auswege aus Stillstand, Streit und Agonie beschreiben. Dazu habe ich eine Vielzahl von Gesprächen geführt. Danke an die Mitglieder von solid, Vertreter*innen aus dem Parteivorstand und Landesverbänden, die Abgeordneten aus der Bundestagsfraktion und Landtagen sowie weitere Akteur*innen unterschiedlicher Strömungen, die mit mir sehr ehrlich gesprochen haben. Viele dieser Gedanken sind in die nachstehenden Überlegungen eingeflossen. Für alles, was die Leser*innen falsch finden, trage natürlich ich allein die Verantwortung.
Worum es mir nicht geht, ist der Geländegewinn für irgendeine Strömung. Es geht mir um DIE LINKE als Partei mit dem Selbstverständnis einer Pluralen Linken.
Eine neue politische Kultur der Pluralen Linken
Nach der Saar-Landtagswahl las ich einige relativierende Hinweise auf die Kleinheit des Saarlandes oder die mit 750 000 Wähler*innen überschaubare Größe des Elektorats. Ich hielt dies für ebenso deplatziert wie die vielen mehr oder weniger subtilen Beleidigungen, die auf Twitter und Facebook nachzulesen waren und teilweise Eingang in die großen Nachrichtenmagazine gefunden haben.
Halten wir einmal ganz nüchtern fest: Zwischen dem Herbst des vergangenen Jahres und Ende März 2022 hat DIE LINKE in elf Sonntagsfragen von Infratest dimap – bei einem Wähler*innenpotenzial von nicht weniger als 20 Prozent – durchschnittliche Zustimmungswerte 4,8 Prozent erreicht. Sie würde damit die Fünf-Prozent-Hürde zum Einzug in den Bundestag erneut verpassen. Bei den Sonntagsfragen der Forschungsgruppe Wahlen kämen wir im Durchschnitt des gleichen Zeitraums auf knappe 5,4 Prozent und bei Allensbach auf 5,3 Prozent. Immerhin.
Dass es anders geht, zeigten wir mit unserem Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten, dem Sozialmediziner Gerhard Trabert. Eine Persönlichkeit, die durch ihre bisherige Tätigkeit gezeigt hat, für welche Werte eine sozialistische Gerechtigkeitspartei steht. Sofort stiegen auch die Zustimmungswerte für DIE LINKE. Sie war erkennbar als Partei mit einer Idee, statt der Methode Selbstzerstörung. Doch ein Gerhard Trabert macht noch keinen Neustart.
Betrachten wir deshalb unsere heutige Ausgangslage: DIE LINKE ist seit dem 27. März 2022 nur noch in einem Landtag eines westdeutschen Flächenlandes vertreten und darüber hinaus in den Bürgerschaften Hamburgs und Bremens. In letzterem stellt sie gemeinsam mit SPD und Grünen die Landesregierung. In Hessen wird im kommenden Jahr gewählt. Dort begann seinerzeit der Einzug der LINKEN in westdeutsche Flächenland-Landtage, zu denen zwischenzeitlich NRW, Niedersachsen und das Saarland hinzukamen.
In Hessen kann sich im kommenden Jahr also ein Kreis schließen: Entweder DIE LINKE Repräsentanz in der westdeutschen Fläche endet dort, wo sie begann – oder DIE LINKE steht wieder auf und macht es besser als bisher.
Kurzum: Derzeit liegt unsere Partei DIE LINKE am Boden. Dort ist sie schmerzhaft aufgeschlagen: Bei der Europawahl 2019 ebenso wie bei der Bundestagswahl 2022. Die Verantwortung dafür liegt ausschließlich bei uns selbst. Gestolpert sind wir über die Beine, die wir uns seit Jahren gegenseitig stellen.
Wir können weiterhin an unseren eigenen Widersprüchen scheitern – oder diese Widersprüche auflösen. Es anders und besser machen als bisher. Uns dadurch selbst und andere stolz machen.
Nach dem Wahldebakel im Saarland fordert Dietmar Bartsch einen inhaltlichen Neuanfang und ein Ende des Streits in unserer Partei: Dabei »gehört auch alles andere auf den Prüfstand«, denn die Zerstrittenheit der Partei »muss aufhören, ansonsten werden wir in noch größere Probleme kommen«, wird Dietmar zitiert.
«
Ebenso wie er kündigten auch Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow an, DIE LINKE auf dem Parteitag im Juni in Erfurt inhaltlich neu auszurichten. Dies könne der Auftakt sein, »dass wir uns als Partei neu erfinden«, wird Susanne zitiert. Janine spricht von einer Profilierung als »moderne Gerechtigkeitspartei«, als die unsere Partei dringend gebraucht wird.
Ich unterstütze dies grundsätzlich. Und widerspreche damit auch allen, die der Auffassung sind, die Auswechslung von einzelnen Führungspersonen oder der Austritt weiterer Akteur*innen würde – für sich genommen – die gewünschte Veränderung bringen.
Meiner Auffassung nach können wir jedoch nicht bis zum Erfurter Parteitag warten. Über den notwendigerweise zu gehenden Weg ist nicht erst auf dem Parteitag in Erfurt Klarheit herzustellen. Wir müssen jetzt damit beginnen. Der Parteitag in Erfurt muss bereits sichtbarer Ausdruck der notwendigen und begonnenen Veränderung sein.
Lernen zu streiten und zu entscheiden – ohne zu zerreißen.
In der Süddeutschen Zeitung formulierte Boris Herrmann am 31.03.2021 zutreffend: »Das eigentliche Problem dieser Partei ist aber gar nicht einmal, der inhaltliche Dissens, sondern der Versuch ihn zu unterdrücken. Die Linke streitet nicht zu viel, sondern über die falschen Dinge. Hinter den meisten Selbstzerfleischungen stehen nicht Überzeugungen, sondern Machtfragen.«
Dem stimme ich zu. Es geht wesentlich um die Organisationskultur und die politische Kultur unserer Partei:
- Die Art und Weise wie wir inhaltliche Debatten führen oder eben abwürgen.
- Darum, wie Programmpassagen kanonisiert und zum unhinterfragbaren Dogma erhoben werden.
- Wie Führungskräfte miteinander umgehen und wie dieser Umgang wiederum bis in die Ortsverbände hinein destruktive Wirkung zeigt.
Diese Organisationskultur führt zu einem unauflösbaren Widerspruch: Wir wollen nach außen die Partei der Solidarität und Gerechtigkeit sein und praktizieren miteinander einen wenig solidarischen dafür vielfach offensichtlich ungerechten Umgang.
Deshalb gehört diese Organisationskultur grundlegend verändert – von oben nach unten und von unten nach oben. Als Führungsaufgabe einerseits und als Mitgliederbewegung von unten andererseits. Wer sich dieser Veränderung nicht stellen will, braucht über inhaltliche Veränderungen nicht zu sprechen.
Auf der Hand liegt, dass dieser Veränderungsprozess die Partei ebenso erfassen muss wie ihre Fraktionen. Ich habe mich in der Vergangenheit häufig und kritisch mit der Linksfraktion im Bundestag auseinandergesetzt. Die Erzählungen über die lähmenden und destruktiven Konflikte sind bekannt. Der machtpolitische Dauerkonflikt mit der Parteiführung – der alten wie der neuen – ebenso. Dietmar Bartsch hat angekündigt, dass alles auf den Prüfstand kommt – well done.
Wenn wir diesen Veränderungsprozess ernsthaft beginnen, ihn tatsächlich umsetzen und nicht bei den ersten Rückschlägen in alte Muster zurückfallen, dann wird es wirklich spannend.
Dann debattieren wir nicht nur über die vor uns liegenden inhaltlichen Herausforderungen, Gegensätze und Widersprüche. Dann erkennen wir, dass Streit insgesamt eine dufte Sache ist. Er schafft Klarheit – nach innen und nach außen. Wir wären dann bei dem, was Fabio de Masi eingangs als rationale Linke bezeichnet.
Boris Herrmann nennt ein solches Vorgehen im bereits zitierten taz-Kommentar einen »gesunde[n] politische[n] Streit« und fordert:
»Die Linke sollte endlich offen mit sich ausdiskutieren, wer sie eigentlich sein will: eine Sozialstaatspartei mit grüner Note oder eine Grünenvariante mit Ostkompetenz. Sie müsste darüber streiten, ob sie die Nato jetzt eigentlich auflösen oder reformieren möchte. Ob sie gegen alle Auslandseinsätze ist oder nur gegen Kriegseinsätze. Ob sie mit der Arbeiterklasse vor allem den wohnungssuchenden Studentenjobber in der Großstadt meint, die Pendlerin auf dem Lande oder die Erntehelfer mit Migrationshintergrund. Das alles müsste breit debattiert, dann aber auch mal entschieden und festgeschrieben werden. Eine Partei, die dieser Art von Streit aus dem Weg geht, bietet keinen Anlass, sie anzukreuzen.«
Produktiver Streit ist freilich – darauf haben mich einige, die diesen Text kritisch vorab gelesen haben, hingewiesen – nur eine Seite der Medaille. Am Ende jeder Debatte muss eine Entscheidung stehen. In der bisherigen politischen Verfasstheit unserer Partei erscheint jede tatsächliche Entscheidung in einer kontrovers diskutierten Frage wie eine Zerreißprobe.
So sicher wie das Singen der Internationale am Ende eines linken Bundesparteitages wird es – egal welche Entscheidung z.B. bei dem im Herbst stattfindenden Mitgliederentscheid zum Bedingungslosen Grundeinkommen (BGE) oder im Hinblick auf die Außen- und Sicherheitspolitik der LINKEN getroffen werden – Genoss*innen geben, die deshalb meinen, aus der Partei auszutreten. Das ist die Folge einer Konfliktkultur nach dem Muster: »Auf zum letzten Gefecht«.
Da wir aber nicht weiterhin aus Angst vor dem Tod Selbstmord begehen können, schlage ich vor:
1. Der Parteivorstand setzt bereits vor dem Erfurter Parteitag eine zeitlich befristete Kommission ein – ich würde sie »Grundwertekommission« nennen« –, die u.a. zu den Themen:
a) Herausforderungen einer zeitgemäßen linken Außen- und Sicherheitspolitik
b) Linke Beiträge für die »Konferenz zur Zukunft Europas«
c) Erfordernisse sozial-ökologischer Industriepolitik […]
d) eine Auswertung der vorliegenden strategischen und programmatischen Beiträge vornimmt.
Dabei sollen die Gemeinsamkeiten herausgearbeitet werden, um sie zum Gegenstand der politischen Bildungsarbeit der Partei zu machen. Die bestehenden Dissense werden benannt und in einem transparenten Werkstattprozess zeitlich befristet diskutiert.
Die Ergebnisse dieses Streits werden auf dem nach Erfurt folgenden Parteitag erörtert und entschieden. Diese Abstimmungsergebnisse werden anschließend den Mitgliedern zur Abstimmung vorgelegt.
Die Debatte auf dem Erfurter Parteitag dient in diesem Sinne bereits der Vorbereitung des Klärungs- und Entscheidungsprozesses.
2. Wir verzichten innerhalb dieses Prozesses auf gegenseitige Unterstellungen, nach denen nunmehr begonnen würde »das Fähnchen in den Wind« zu hängen, »den Markenkern der LINKEN zu schleifen« etc. Das nützt keiner Debatte und macht nur schlechte Stimmung – und davon haben wir ja bereits mehr als genug.
Die Frage, was mit unserer Partei geschieht, wenn wir nicht nur klug streiten, sondern letztlich auch entscheiden ist keineswegs banal. Denn befürchtet wird, dass die Fliehkräfte größer sein könnten als die Bindungswirkung eines solchen Prozesses. Ich setze der Befürchtung die Überzeugung entgegen, dass sowohl Fliehkräfte als auch neue Bindungswirkungen erzeugt werden. Ergänzt um eine neue Anziehungskraft für Menschen, die bisher nicht zu uns kommen wollen.
Fallbeispiel: »Kollektives Europäisches Sicherheitssystem unter Einschluss Russlands«
»Gebraucht wird eine linke Kraft, die entschieden und unbeirrt Kurs auf Völkerrecht, Entspannung und Diplomatie in der Außenpolitik hält«, sagt Sevim Dagdelen. Dagegen hat niemand innerhalb der Linkspartei etwas einzuwenden. So fordern wir im Erfurter Programm, beschlossen im Oktober 2011, die Auflösung der NATO und ihre Ersetzung durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Beteiligung Russlands, das Abrüstung als ein zentrales Ziel hat. Unabhängig von einer Entscheidung über den Verbleib Deutschlands in der NATO wird DIE LINKE laut Erfurter Programm in jeder politischen Konstellation dafür eintreten, dass Deutschland aus den militärischen Strukturen des Militärbündnisses austritt und die Bundeswehr dem Oberkommando der NATO entzogen wird.
Diese Position vertrat seit Mitte der 1990er Jahre bereits die PDS. Sie forderte in ihrem Programm ein neues »kollektives Sicherheitssystem« für ganz Europa als Alternative zur NATO und der WEU. Schon im Kommentar des PDS-Programms aus dem Jahr 1997 heißt es: »Dabei ist die PDS zu realistischen Alternativen, zu schrittweisen Veränderungen bereit, denn die tiefverwurzelten, jahrhunderte-, jahrtausendealten Sicherheitsvorstellungen können auch nur mit realen neuen Erfahrungen überwunden werden.«
Wie diese Alternativen oder schrittweisen Veränderungen konkret aussehen würden, blieben bereits die PDS und später die Linkspartei schuldig. Im Jahre 1995 war die Auflösung des Warschauer Pakts am 31. März 1991 gerade vier Jahre her. Die Sowjetunion gehörte mit der Beloweschen Vereinbarung vom Dezember 1991 ebenfalls erst knapp vier Jahre der Vergangenheit an. Die Forderung, im Ergebnis des Zerfalls der Sowjetunion und der Auflösung des Warschauer Paktes auch die NATO als Produkt des Kalten Krieges zu ersetzen und einzubetten in einen europäischen Einigungsprozess war also hochaktuell.
Die PDS, die Linkspartei/PDS und DIE LINKE haben es – über einzelne Spezialist*innen hinaus – versäumt, in dieser für das Selbstverständnis der Außen- und Sicherheitspolitik so essentiellen Frage ernsthaft und nachvollziehbar konkrete Vorschläge zu entwickeln. Und deutlich zu machen, wie sich diese Forderung zu seither erfolgten weltpolitischen Entwicklungen – den Balkankriegen, 9/11, dem Irakkrieg, der russischen Invasion in Georgien und der Ost-Ukraine, der Präsidentschaft Trumps etc. – verhält. Müssen Anpassungen vorgenommen werden und wenn ja, welche und warum?!
Fallbeispiel: »Vereinigte Staaten von Europa« und künftige EU-Erweiterung
Eine der klügsten Debatten führte die Linkspartei um die »Vereinigten Staaten von Europa« im Vorfeld der vergangenen Europawahl 2019. Die Entscheidung war am Ende ein Kompromiss. Die brüchige Illusion einer Einheit der Partei wurde wie so oft der Klarheit von Form und Inhalt vorgezogen. Eine mutige und proeuropäische Aussage unterblieb. Die Partei verlor auch im Ergebnis dessen massiv. Der Idealismus der Vereinigten Staaten von Europa hatte das Potential, auch die Versäumnisse eines neuen kollektiven Sicherheitssystems zu überwinden, wie Thomas Händel und Frank Puskarev bereits 2013 in der Zeitschrift Luxemburg überzeugend ausführten und wie die Puls of Europe-Bewegung seinerzeit zeigte.
In die derzeit laufende »Konferenz zur Zukunft Europas« müssten wir uns als LINKE mit einer pro-europäischen Position vernehmlich einbringen und deutlich machen, dass eine zukunftsfähige EU insbesondere eine funktionierende Sozialunion benötigt. Gleichzeitig müssen wir diese Debatte nutzen, um uns miteinander zu verständigen, wie eine künftige EU-Erweiterung ausgestaltet werden soll, wie es gelingen kann, progressive Politik unter Verzicht auf Einstimmigkeitserfordernisse etc. durchzusetzen. Und das sind nur einige der spannenden Fragen, denen wir uns stellen können und dabei andere mitreißen.
Radikaler Wandel im Haus DIE LINKE
Im vergangenen Jahr habe ich begonnen, Gespräche mit unterschiedlichsten Akteur*innen der LINKEN zu führen. Bewegungslinke, solidarische Linke, sozialistische Linke, Reformer*innen…, Jugendverband, Bundestagsabgeordnete, Vorstände, …. In diesen sehr offenen Gesprächen wurde deutlich, dass jede*r für sich mit dieser Partei Wünsche und Hoffnungen sowie vielfach tiefsitzende akkumulierte Enttäuschungserfahrungen verbindet.
Nur Wenigen, darunter Vertreter*innen des Jugendverbandes, den vormaligen Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger, dem Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler, war tatsächlich bewusst, wie sehr unsere Partei DIE LINKE im Umbruch begriffen ist.
Katharina Dahme (Bewegungslinke) formulierte in »Gedanken zur Linken nach der Bundestagswahl 2021«:
»In dem Haus DIE LINKE wohnen viele und das Fundament ist stabiler als manche nach den 4,9 Prozent befürchten. Rissig ist es trotzdem, weil die Gemeinsamkeiten, die nun wieder viele einfordern, in Frage gestellt wurden und auch weiterhin nicht von allen akzeptiert werden.«
DIE LINKE als ein Haus zu sehen ist ein spannender Gedanke, der viele Anknüpfungspunkte bietet.
Schauen wir nur auf die absoluten Zahlen, verlor DIE LINKE in den vergangenen zehn Jahren knapp 9.000 Mitglieder (2011: 69.458 Mitglieder, 2021: 60.670). Der Wandel war jedoch tiefgreifend:
- 26.231 Mitglieder traten zwischen 2011 und 2021 aus der Partei aus. Davon waren rund 14.500 Mitglieder zwischen 60 und älter als 81 Jahre,
- etwas mehr als 14.500 Mitglieder verstarben im Zeitraum 2011 bis 2021 und
- 31.541 Mitglieder, also mehr als die Hälfte der heutigen Mitgliedschaft, traten der Partei seit 2011 bei.
Von diesen 31.541 Mitgliedern waren mit Stand Ende 2021 knapp 21.000 Mitglieder, dies ist ein Drittel der Gesamtmitgliedschaft im Alter zwischen 14 und 40 Jahren.
Im Vergleich der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien (ohne AfD) verzeichnete DIE LINKE – bezogen auf den Zeitraum 2008 bis 2019 – die höchste Zahl an Sterbefällen und gewann gleichzeitig überproportional viele junge Mitglieder.
Dieser Generationswechsel vollzieht sich ungleichmäßig sowohl zwischen Ost und West als auch zwischen urbanem und ländlichem Raum. Die ostdeutschen Landesverbände verlieren stärker von hohen Mitgliederzahlen kommend, während die westdeutschen Landesverbände auf niedrigerem Niveau anwachsen und – bezogen auf die Gesamtmitglieder – signifikant jünger sind als in den nicht mehr so neuen Ländern.
Dieser Wandel findet wiederum innerhalb eines Veränderungsprozesses in den gesellschaftlichen Milieus statt und hat ebenfalls Wirkung auf DIE LINKE und die sie wählenden Milieus. Ein Beispiel: Im Jahre 2006 wiesen die sogenannten Sinus-Milieus noch eine Gruppe von ca. 6 Prozent auf, die als »DDR-Nostalgische« bezeichnet wurden. Dieses Milieu sah insbesondere in der PDS bzw. der Ost-Linken ihre Repräsentanz. Dieses Milieu hat sich über den Verlauf der vergangenen 16 Jahre als eigenständiges Milieu aufgelöst – und damit auch als eine adressierbare gesellschaftliche Gruppe. Die Artikulation ostdeutscher Interessen findet deshalb heute in anderen Formen statt und benötigt demzufolge eine veränderte Form der Artikulation seitens der LINKEN. Dass 38 Prozent der von Infratest dimap befragten Ostdeutschen zur Bundestagswahl 2021 der Auffassung waren, DIE LINKE »vertritt am ehesten meine Interessen« und dies der höchste Parteienwert war, ist eine gute Ausgangsbasis.
Wer sich diesen fundamentalen Wandel im Parteihaus DIE LINKE und in dem gesellschaftlichen Umfeld vor Augen führt, muss erkennen, dass diese Umwälzung der Mitgliederstruktur in Verbindung mit einer sich ebenfalls fundamental veränderten politischen Gesamtlage einerseits Wirkungen zeigt, die andererseits nicht mehr mit einem Rückgriff auf frühere Erfolgsrezepte der Jahre 2005 oder 2009 beantwortet werden können.
Stattdessen gibt es gute Gründe für den Umbau des Parteihauses DIE LINKE:
- Neue Heimat: Wir wollen sehr unterschiedlichen Menschen eine politische Heimat geben;
- Mehrgenerationenhaus: Die Alterspyramide dreht sich sukzessive um. Damit ändern sich auch die Bedürfnisse bei der Raumnutzung und Raumgestaltung;
- Gutes Wiederentdecken: Neue Herausforderungen bieten Gelegenheit, Altes wieder zu entdecken oder auch in neuer Form zu nutzen;
- Behutsam ausmisten: Von Einigem können wir uns trennen, weil wir es nicht mehr benötigen, ohne aus Versehen, Wichtiges über Bord zu werfen;
- Nachhaltig und attraktiv: Kein Substanzerhalt ohne Modernisierung – und umgekehrt. Der Umbau des Parteihauses schafft Nachhaltigkeit und Attraktivitätsgewinn;
- Offene Türen: die Türen öffnen, mehr Austausch mit der Umwelt, Pflege des Umfeldes.
Wie wollen wir leben? Diese Frage stellte schon Walter Gropius, der Mitbegründer des Bauhauses und diese Frage kann auch uns prägen, wenn wir das Parteihaus zum Volkshaus werden lassen wollen. Das wiederum wäre der zweite Schritt nach dem ersten Schritt und eine gesonderte Betrachtung wert.
Aufgrund der vorgenannten Argumente und Daten plädiere ich für die oben dargestellte Arbeit einer zeitlich befristeten »Grundwertekommission« sowie die Entscheidung über die Ergebnisse der Kommission und der Beschlüsse des darauf folgenden Parteitages durch die Mitglieder. Das Parteiprogramm wurde 2011 beschlossen. Seitdem sind 19.500 Mitglieder ausgetreten, 20.000 Mitglieder eingetreten und 14.500 Mitglieder verstorben. Es macht Sinn, sich auf diese Weise partizipativ über unsere Grundwerte zu verständigen.
Zum Abschluss ein Verweis auf einen klugen Kommentator, der in der kritischen Durchsicht einer Entwurfsfassung dieses Textes schrieb:
»Das >Generationenproblem< hat meines Erachtens vor allem mit den erschöpften Gründungsimpulsen PDS und WASG zu tun, deren Protagonisten fortleben, während die Jüngeren nach einem neuen Verständnis demokratisch-sozialistischer Politik suchen. Vielleicht sollten sich die über 60-Jährigen da raushalten, aber immer wieder darauf hinweisen, dass ohne den Rückhalt unter den Baby-Boomern keine Wahlen zu gewinnen sind. Die generationelle Asymmetrie unter den Wahlberechtigten, die damit verbundenen jeweiligen biographischen Stadien, scheinen mir das eigentliche Problem zu sein, an dem sich abzuarbeiten wäre.«
DIE LINKE ist in dieser Lesart ein Mehr-Generationen-Haus – und es soll aus dem Parteihaus im besten Sinne ein Volkshaus werden.
Sozial-ökologische Gerechtigkeit
Beim Umbau des Parteihauses DIE LINKE gäbe es, wie ich ausgeführt habe, manch Spannendes wiederzuentdecken. Ein Beispiel: Heftig wird derzeit darum gerungen, ob DIE LINKE sich als ökosozialistische Partei verstehen solle. Sollen wir grüner werden als Die Grünen fragen die Einen besorgt – sind wir doch selbstverständlich, antworten die Anderen.
Man könnte die Debatte auch anders beginnen. Im Parteibildungsprozess der grünen Partei gab es einen starken linken Flügel, der sich als Ökosozialist*innen bezeichnete und sich aus verschiedenen, der studentischen APO entstammenden K-Gruppen speiste. Dieser ökosozialistische Flügel schied über den Verlauf der 1980er Jahre aus den Grünen aus. Einige davon stießen nach 1990 zur PDS, andere über die WASG zur LINKEN. Insgesamt gehört der Öko-Sozialismus also zweifelsohne zu den vielfältigen Traditionsgewässern, die unsere demokratisch-sozialistische Strömung speisen.
Bernd Riexinger hat zusätzlich in den ersten sieben von neun jüngst veröffentlichten Thesen zur inhaltlichen und praktischen Weiterentwicklung der Partei DIE LINKE klug und nachvollziehbar dargelegt, dass der »Zukunftsentwurf einer sozialen, solidarischen und klimagerechten Gesellschaft« die konkreten bestehenden Forderungen der LINKEN verbindet und »von konkreten Reformvorschlägen bis hin zu ökosozialistischen Vorstellungen […] die Vorschläge dafür längst auf dem Tisch [liegen].» Aus seiner Sicht erweitern diese Elemente, zu einem Ganzen verbunden, »unser bisheriges Hauptfeld der sozialen Gerechtigkeit durch Klimagerechtigkeit«.
In diesem Sinne argumentiert beispielsweise auch Markus Wissen, der in der PROKLA das »Verhältnis von ökologischen und sozialen Konflikten« betrachtet und optimistisch formuliert: »[…] Zehntausende hochqualifizierter Ingenieure, Techniker und Facharbeiter in den Autobetrieben und -regionen sind ein dafür aktivierbarerer Think-Tank, wenn ihre Kreativität und Qualifikation nicht mehr wie in den letzten Jahrzehnten auf anachronistische Ziele fokussiert wird.« (Wissen: 2020: 459)
Was wir zur Kenntnis nehmen müssen ist freilich, dass die »Ökologische Transformation der Industrie« einschließlich der »Konversion klimaschädlicher Industrien mit Beschäftigungs- und Einkommensgarantien« (vgl. Riexinger-These 3 e) sowohl bei den Beschäftigten der betreffenden Industrien als auch innerhalb der Industriegewerkschaften gleichzeitig auf normative Akzeptanz und erhebliche Skepsis stoßen wird. Was auch nachvollziehbar ist. Denn die Erfahrungen des Strukturwandels in der Steinkohle, den Werften, der Stahlindustrie ebenso wie innerhalb der ostdeutschen Gesellschaft vollzogen sich bislang unter den Bedingungen der Dominanz von Kapitalinteressen und eines radikal asymmetrischen Machtverhältnisses zuungunsten der Lohnabhängigen.
So beschreiben Stefan Schmalz u.a. in der Studie »Abgehängt im Aufschwung. Demografie, Arbeit und rechter Protest in Ostdeutschland« eine Ausgangslage, die man zur Kenntnis nehmen muss:
»Im Alltagsleben vieler Menschen hat sich über Jahre hinweg eine große Unzufriedenheit aufgestaut. Ältere Ostdeutsche beklagen die Missachtung der erbrachten Lebensleistung. Jüngere können trotz verbesserter Arbeitsmarktperspektiven nicht zwangsläufig davon ausgehen, eine stabile und auskömmliche Beschäftigung zu finden. Angesichts niedriger Entlohnung und mangelnder Mitsprachemöglichkeiten am Arbeitsplatz hat sich das Ungerechtigkeitsempfinden verfestigt, und Einstellungen haben sich radikalisiert. Zusammen mit dem Vertrauensverlust in die politischen Eliten und Institutionen ist im Osten ein Gefühl von Ohnmacht und ein diffuses Gefühl von Verunsicherung entstanden.«
Wenn Markus Wissen folglich ein gewerkschaftliches Problem diagnostiziert, dass seiner Meinung nach darin besteht, dass »die Anerkennung des sozial-ökologischen Wandels […] auf eine Weise [geschieht], die den Gegensatz zwischen Ökologie und Arbeit reproduziert, statt ihn zu überwinden«, ist das nur die normative halbe Miete.
Die Klimapolitik in Deutschland war bisher, wie Ulrike Herrmann in einem taz-Kommentar prägnant zusammenfasste und an Beispielen ausführte »zutiefst ungerecht«. Die Sinus-Milieus 2021 zeigen, dass Nachhaltigkeit keine Frage mehr des »Ja« oder »Nein« ist, sondern milieuübergreifend handlungsleitend im Alltag. Aber in Teilen der unteren Mitte und der sozial Deklassierten wachsen angesichts neuer Verteilungskämpfe die Furcht vor den Kosten und die Sorge um Teilhabe.
Mit Blick auf die dramatisch gestiegenen Energiepreise erscheint noch richtiger, was Ulrike Herrmann im vergangenen Sommer in der taz schrieb:
»Umweltökonomen sind sich einig, dass das Energiegeld am gerechtesten wäre. Die Einnahmen aus der CO2-Steuer würden an die Bürger zurückverteilt – und zwar gleichmäßig pro Kopf. Da die Armen nur halb so viel Energie verbrauchen wie die Reichen, würden sie also mehr Geld erhalten, als sie je an Steuern gezahlt haben.«
Die linke Debatte über den sozialökologischen Systemwechsel, die Forderungen nach einem radikalen Klimaschutz und einem schnelleren Ausstieg aus der Kohle, der zügige Umstieg auf eine ökologisch nachhaltige Landwirtschaft ist einerseits konzeptionell zu führen.
Und andererseits ist es Aufgabe der LINKEN als Gerechtigkeitspartei deutlich zu machen, dass Klimapolitik stets und immer Gerechtigkeitspolitik sein muss. Ich sehe hierin eine unserer wesentlichen Aufgaben in der Gestaltung der sozial-ökologischen Transformation. Denn es sind gerade ärmere Menschen und einfache Arbeitnehmer*innen, zu deren Lasten die bisherige und gegenwärtige Klimapolitik geht und ich sehe in Bewegungen wie Fridays for Future diesbezüglich zumindest Nachholbedarf und partielle Leerstellen. Einige werden einwenden – aber das tun wir doch bereits. Dann sollten wir es auch so tun, dass es tatsächlich alle mitbekommen.
In einer Auswertung der Bundestagswahl formulierte die Sozialistische Linke das Erfordernis einer übergreifenden Erzählung, in der »unsere Interessenvertretungs- und Reformpolitik im Kapitalismus und für eine sozial-ökologische Transformation überzeugender als bisher […] mit marxistisch fundierter Kapitalismuskritik« verbunden wird: »Der Erzählung vom Kampf für den Aufbau einer besseren, menschlicheren, demokratisch-sozialistischen Gesellschaft, die die Ausbeutung von Natur und Umwelt überwindet«. Es ist nur ein Beispiel, dass es sich lohnt, statt der ständigen Betonung von Gegensätzen die Gemeinsamkeiten zu sehen und zu würdigen.
Sozialistische Gerechtigkeitspartei
Knapp die Hälfte der Deutschen (45 Prozent) ist laut Befragung von Infratest dimap bei der Bundestagswahl 2021 der Auffassung, dass es in Deutschland eher ungerecht zugeht, 51 Prozent meinen, es ginge eher gerecht zu. Unter den Wähler*innen der LINKEN meinen mehr als Dreiviertel (78 Prozent), dass eher ungerecht zugeht, von den AfD-Wähler*innen sind 85 Prozent dieser Meinung.
Differenziert nach Ost und West meinen 56 Prozent der Ostdeutschen und 42 Prozent der Westdeutschen, dass es in Deutschland eher ungerecht zugeht.
Dass der Wohlstand in Deutschland nicht gerecht verteilt ist, davon sind 82 Prozent der Ostdeutschen und 75 Prozent der Westdeutschen überzeugt. Gesamtdeutsch sind 77 Prozent aller Befragten überzeugt, dass die Wohlstandsverteilung nicht gerecht ist. Nach Parteien differenziert sind 96 Prozent der LINKE-Wähler*innen, je 86 Prozent der Wähler*innen von SPD und AfD und 82 Prozent der Grünen-Wähler*innen dieser Meinung.
Dass Gerechtigkeit für die Menschen in Deutschland eine große Bedeutung hat, wird bereits aus den vorgenannten Zahlen von Infratest dimap deutlich, findet seine Entsprechung aber auch in weiteren Studien. So beispielsweise bei »more in Common« 2019. Dort gaben ebenfalls rund drei Viertel (72 Prozent) an, sich häufig mit der Frage Gerechtigkeit zu befassen. Innerhalb der gesellschaftlichen Gruppen ist das Ungerechtigkeitsempfinden ungleich verteilt. Während rund zwei Drittel (63 Prozent) meinen, es geht in Deutschland eher ungerecht zu, sind die von More in Common identifizierten Gruppen der »Enttäuschten« und der »Wütenden« zu 85 bzw. 84 Prozent dieser Überzeugung.
Selbstverständlich differiert auch, was unter Gerechtigkeit konkret verstanden wird. Doch gibt es auch in der Differenz Gemeinsamkeiten, wie die Autor*innen in der More in Common-Studie zeigen:
- Jede*r soll von der eigenen Arbeit leben können,
- Jede*r soll im Alter gut abgesichert sein,
- Die Schere zwischen Arm und Reich soll nicht zu groß werden.
Noch einmal zurück zu Infratest dimap: Knapp zwei Drittel (61 Prozent) stimmen zu, für einzelne Gruppen die Steuern zu erhöhen. Darunter sind 88 Prozent der LINKE-Wähler*innen sowie 86 Prozent Grüne- und 79 Prozent SPD-Wähler*innen. Ablehnen tun dies übrigens mehrheitlich die Wähler*innen der Union (54 Prozent) und von AfD sowie FDP (je 59 Prozent).
Für eine sozialistische Gerechtigkeitspartei gibt es also genug zu tun. Insbesondere auch auf der konzeptionellen Ebene. Statt uns also gegenseitig vorzuwerfen, die Interessen der Arbeiter*innen, Arbeitslosen und Rentner*innen nicht mehr zu vertreten, kommt es darauf an, gemeinsam zu zeigen, wie unter den aktuellen Bedingungen multipler Krisen (Kriege, Klimawandel, Pandemie…) Gerechtigkeit herstellbar ist und in entsprechende Kämpfe als Gerechtigkeitspartei einzugreifen.
Kritisch eingewandt wurde von Leser*innen der Entwurfsfassungen dieses Textes, dass es sich bei dem von mir vorgeschlagenen Narrativ »nur um eine Erneuerung von >Wir sind die Partei der sozialen Gerechtigkeit<« handeln würde und die Definition dessen, was gerecht sei dem politischen (Deutungs-)Kampf unterliege und abhängig sei von Vorstellungen über die gute Gesellschaft. Es kommt deshalb darauf an, dass wir als DIE LINKE bereit sein müssten, über entsprechende Ordnungsvorstellungen zu sprechen.
Einschub: Umgang mit der Ampel als moderne sozialistische Gerechtigkeitspartei
Die Ampel-Koalition wird eine gesellschaftspolitische Modernisierung vorantreiben. Daran ändert auch die Entscheidung über das Bundeswehr-Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro nichts.
Es ist richtig grundsätzlich erstmal, jede Entscheidung der Ampel von links zu kritisieren. Aber (!) wenn wir unseren Kompass anlegen, dann können wir darüber hinaus darstellen und begründen, wie es anders gemacht werden müsste und (!) wir können auch begründen, warum wir bestimmte Entscheidungen mittragen. Weil sie sinnvoll sind und keine Ungerechtigkeit nach sich ziehen.
Wir legen also einen für alle nachvollziehbaren Kompass als moderne sozialistische Gerechtigkeitspartei an: Wir unterstützen diejenigen Vorhaben, die für mehr Gerechtigkeit in unserem Land sorgen. Wir lehnen die Vorhaben ab, die Ungerechtigkeit aufrechterhalten oder neue Ungerechtigkeiten schaffen. Wir zeigen, beispielsweise beim Klimaschutz, im Gesundheitswesen, bei der Umverteilung von oben nach unten, wo Gerechtigkeitsdefizite bestehen und unsere Forderungen zeigen, wie mehr Gerechtigkeit hergestellt wird.
Wir sind weder die bessere SPD, noch die grüneren Grünen. Wir sind die moderne sozialistische Gerechtigkeitspartei. Damit tragen wir zu einem mehrheitsfähigen gesellschaftlichen Mitte-Links-Lager bei.
Linke Werkzeuge für das Haus der LINKEN
Ich habe oben davon gesprochen, dass unser Parteihaus DIE LINKE sich im Umbau befindet. Und die Partei hat dabei spannende Erfahrungen gesammelt. Es wurden Organizer*innen ausgebildet und bundesweit Erfahrungen mit dieser Methode der Aktivierung, des Empowerment gesammelt. Der Begriff »Empowerment« ist mehr als ein anglizistisches Modewort. Er beschreibt eine Methode, die auf – wie das Wort schon sagt – Ermächtigung derjenigen setzt, die in dieser Gesellschaft gemeinhin wenig Macht zugesprochen bekommen.
Es wurden in den Wahlkämpfen und jenseits davon Haustürgespräche geführt. Die wirken nicht nur in den urbanen Regionen, sondern überall dort wo Menschen diese Art der aktivierenden Ansprache als ersten Schritt der Teilhabe empfinden. In Zeitz (Sachsen-Anhalt) hat sich zum Beispiel gezeigt, dass die Ansprache von Nachbar*innen eine große Qualität der eher älteren ostdeutschen Genoss*innen ist.
Die Partei hat die gesammelten Erfahrungen ausgewertet, Schlussfolgerungen gezogen. Aus ursprünglich vier Modellprojekten wurde inzwischen eine politische Praxis mit Schulungen, Neumitgliedern und dem Anspruch, linke Politik jenseits der Metropolen zu machen.
Nun kommt es wiederum darauf an, im Rahmen einer veränderten Organisationskultur von unten und von oben, diese Erfahrungen anzuwenden und zu verbreitern. Nochmal zur Erinnerung: Ein Drittel unserer Mitgliedschaft ist zwischen 14 und 40 Jahren.
In den strategischen Debatten, die in den vergangenen Jahren innerhalb der LINKEN geführt wurden, sind viele kluge Vorschläge unterbreitet worden. Diese gehen leider unter, wenn vorrangig die Wiederholungen bekannter Standpunkte über den Schützengräben der vermeintlich feindlichen innerparteilichen Linien abgeworfen werden.
Werkzeug: Verbindende Klassenpolitik
Während und nach der Amtszeit von Katja Kipping und Bernd Riexinger ist manche ungerechte Kritik an ihnen als Parteivorsitzende geäußert worden. Über diese Kritik wurde vor allem versäumt, zu erkennen, dass der von Beiden popularisierte Ansatz der »Verbindenden Klassenpolitik« einen wirklichen Mehrwert für DIE LINKE darstellt.
Im Kern geht es darum, dass sich die Klassenposition nicht mehr allein aus dem Betrieb als Organisationsform des unmittelbaren Produktionsprozesses ergibt. Klassenkonflikte finden in Betrieben und in anderen Feldern des Lebens statt, auch wenn sie sich dort nicht unmittelbar als solche artikulieren. Miet- und Wohnverhältnisse, Öffentliche Daseinsvorsorge, kulturelle Fragen, Kämpfe um öffentliche Räume, Reproduktion, Bürger*innenrechte, Care-Arbeit (Sorge-Arbeit), Bildung sind nicht allein Kämpfe um Solidarität und Gerechtigkeit, sondern tragen Klassencharakter.
Bereits 2019 schrieb Rhonda Koch einen lesenswerten und sehr praxisorientierten Beitrag »Was bedeutet verbindende Klassenpolitik?«. Darin führt sie aus:
»Bei verbindender Klassenpolitik geht es einerseits darum, unterschiedliche Kämpfe miteinander zu verbinden. Andererseits steckt im Anspruch verbindendender Klassenpolitik auch die Herausforderung, unterschiedliche Lebensbereiche in Kämpfen zusammenzubringen und dabei andere, neue Wege zu finden, um das Verhältnis von Politik und Ökonomie, von Ausbeutung und Unterdrückung, von Lohnkampf und dem Kampf um politische Rechte zu vermitteln. Vielleicht hilft also ein anderer Blickwinkel. Einer der von den Lebensbereichen der Menschen ausgeht, um die Klasse zu verbinden. Nehmen wir das Verhältnis von Arbeit und Nachbarschaft: Wenn wir erstmal begriffen haben, dass Arbeiter*innen, auch nachbarschaftliche, stadtpolitische und andere Interessen haben, geht es im ersten Schritt nicht darum, die Arbeiterin mit der Klimaaktivistin zusammenzubringen. Die Frage ist: Wie und wo trifft Klimapolitik auf die Lebensbereiche und Interessen der Arbeiterin. […]«
Auch hier sei auf bereits geäußerte Vorbehalte gegenüber dem Konzept der Verbindenden Klassenpolitik hingewiesen, weil dies für die hoffentlich entstehende Debatte dieses Textes wichtig ist. Kritisiert wurde, der Ansatz sei eine »politisch zahnlose Kopfgeburt, gut um zu bestimmten Zeiten der Parteientwicklung ein paar Kräfte zusammenzuführen. Tatsächlich verbirgt sich dahinter bestenfalls doch die alte Arbeiterbewegungsweisheit, dass stabile politische Formationen, also Stammwählerschaften, nur über gelungene Milieubildung (hier im Sinne von geteiltem Alltagsleben, Kultur, Zeichen) entstehen können. Sinn macht die Rede von der >verbindenden Partei< nur dann, wenn sich unterschiedliche soziale Figuren in der Partei wiedererkennen, erkannt und gemeint fühlen und sehen […].«
Werkzeug: Kommunalsozialismus
Die Idee des Kommunalsozialismus ist so alt wie die Möglichkeit der Parteien der Arbeiter*innenbewegung, sich in den Kommunen und Räten zu betätigen, in Konsumgenossenschaften oder anderen Formen der Gemeinwirtschaft. Zugrunde liegt der Idee des Kommunalsozialismus der »Schutz und die Förderung der wirtschaftlich schwächeren, nichtbesitzenden Klassen«.
Ich verstehe unter der Re-Aktivierung des Kommunalsozialismus als praktisches Konzept der LINKEN dreierlei:
- Der Satz: »Global denken – lokal handeln« ist bekannt. Unsere Mitglieder sind vornehmlich lokal organisiert. Dort wo sie leben, arbeiten, wohnen, sind sie aktiv. In der Partei und vielfach außerhalb. Grundsätzlich wird in dem Handeln unserer Mitglieder, ob im Kommunalparlament, am Streikposten, in der Nachbarschaftsarbeit die Idee des Kommunalsozialismus praktisch. Sich dessen bewusst zu machen, ist wiederum Aufgabe unserer Bildungsarbeit, die »verbindende Klassenpolitik« und konkretes Handeln vor Ort verbindet.
- Früher wurde gelästert, die Kommunalpolitik sei das »Einfallstor der Reaktion«. Heute können wir zeigen, dass Kommunalsozialismus praktisch werden kann: in Form von öffentlicher Daseinsvorsorge, Infrastruktursozialismus, Genossenschaften und direkter Demokratie.
- Wir wissen ziemlich gut, wie linke Politik in den Großstädten und Metropolen geht. Das ist gut und wichtig. Die Mehrheit der Bevölkerung lebt freilich im ländlichen Raum. Wobei es »den ländlichen Raum« nicht gibt. Denn strukturschwachen, peripheren Regionen jenseits der Städte stehen Regionen gegenüber, die zwar überwiegend dörfliche oder kleinstädtische Prägungen haben aber über Vollbeschäftigung und einen hohen Industriebesatz verfügen. Die linke Praxisaufgabe besteht also darin, das »Recht auf Stadt« um ein »Recht auf Peripherie« zu ergänzen. Es geht auch hier um Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit des Zugangs zu preiswerter und öffentlicher Infrastruktur, Bildung nach dem Grundsatz »Kurze Beine – kurze Wege« und um gemeinwirtschaftliche Organisationsformen von unten.
Kurzum: Sozialismus ist machbar, Herr Nachbar, und wir zeigen vor Ort, wie das geht.
Werkstattprozess: Vom Kümmerismus der KPÖ in Graz lernen
Die KPÖ in Graz hat sich über lange Jahre erfolgreich auf das langfristige Bearbeiten und Besetzen kommunalpolitisch wichtiger Themen, insbesondere im Bereich Wohnen, konzentriert und dabei langfristig Glaubwürdigkeit aufgebaut. Es gelang ihr dort eine auf Dauer angelegte Beziehung herzustellen und darüber »soziales Kapital« aufzubauen. Grundlage dessen ist eine kontinuierliche, verlässliche Basisarbeit. Die gesammelten Erkenntnisse und Erfahrungen im »Organizing« konkreter Nachbarschaftsinitiativen durch DIE LINKE sind wichtiger Lernstoff, der verbreitet und verbreitert werden muss.
Zusätzlich gesteigert wurde diese Glaubwürdigkeit auch dadurch, dass die KPÖ-Abgeordneten im Grazer Stadtsenat, und soweit sie dort vertreten waren auch im Steierischen Landtag, seit 1998 einen Sozialfonds speisten, aus dem inzwischen 2,5 Mio. EUR an über zwanzigtausend bedürftige Personen und Familien vergeben haben.
Authentizität, Glaubwürdigkeit und daraus entstehendes Vertrauen sind das soziale Kapital, das – es kann nicht oft genug betont werden – nur langfristig aufgebaut werden kann aber schnell verspielt.
Kommunalsozialismus und Kümmerismus gehen Hand in Hand und wären Teil der neuen Organisationskultur von oben und unten. Dazu gehört dann auch, das bisherige System der Mandatsträger*innenbeiträge auf allen Ebenen im Sinne des Kümmerismus zu überprüfen.
#linksrutsch2025 und das Spielen der ganzen Klaviatur linker Politik
In einem der ersten Interviews als Parteivorsitzende wird Janine Wissler mit dem ebenso schönen wie richtigen Satz zitiert: »Es rettet uns kein höheres Wesen und keine linke Ministerin oder kein linker Minister«.
In der Grundsatzdebatte ob DIE LINKE regieren dürfe oder nicht sind seit Jahren alle Argumente ausgetauscht und oft genug wiederholt worden. Auf einem Parteitag könnten alle Akteur*innen den Text der jeweils anderen Protagonist*innen aufsagen – die rhetorischen Figuren und Pappkameraden inbegriffen. Andererseits wäre das mal ein spektakulär reflektiertes Parteitags-Highlight, mit dem wir alle anderen und uns selbst überraschen würden…
Im Ernst: Linke Gestaltungspolitik findet seinen Ausdruck in Opposition, in der punktuellen Billigung von Maßnahmen bis hin zu Tolerierungsmodellen und dem Eintritt in Regierungen. Es ist ein Fortschritt, dass über die Abwägung Eintritt in eine Regierung auf Basis eines Koalitionsvertrags die jeweiligen Mitglieder durch Urabstimmung befragt werden. Weder ist Opposition Mist noch jede Regierungsbeteiligung ein Wert an sich. In dieser Argumentation stimme ich beispielsweise mit der Initiative Solidarische Linke überein.
Zur Kenntnis nehmen sollten wir, dass 94 Prozent der linken Wähler*innen bei der Bundestagswahl 2021 der Auffassung waren, dass DIE LINKE regieren sollte und 83 Prozent von ihnen vertraten die Überzeugung, dass nur mit uns Politik für die Ärmsten gemacht werden würde.
Von allen Wählenden bei der Bundestagswahl 2021 waren übrigens mehr als ein Viertel (28 Prozent) der Meinung, DIE LINKE sollte mitregieren – es hat Gründe, dass nur 4,9 Prozent aller Wählenden ihr Kreuz bei uns gemacht haben.
Auch deshalb sind wir in der Pflicht, unsere destruktive Selbstzerstörung zu überwinden, in produktivem Streit bestehende Widersprüche zu klären, offene Fragen zu beantworten, Leerstellen zu füllen und deutlich zu machen: Wir schreiben nicht nur »13 Euro Mindestlohn« auf ein Plakat, sondern wir wollen das auch tatsächlich umsetzen. Ich betone das deshalb, weil eine Erkenntnis der Bundestagswahl auch darin besteht, dass Wähler*innen im Zweifel lieber für 12 Euro stimmen, die auch tatsächlich kommen.
Wenn wir also aufhören mit dem Streit darüber, ob wir auf dem Trockenen Schwimmübungen machen, sondern praktische Vorbereitungen für den Ernstfall der konkreten gestaltungspolitischen Durch- und Umsetzung unserer Forderungen als moderne sozialistische Gerechtigkeitspartei treffen – inhaltlich, strukturell, personell – dann müssen wir auch dafür sorgen, dass es in diesem Land wieder eine Mehrheit links der Mitte gibt. Diese Mitte-Links-Mehrheit herzustellen liegt maßgeblich in unserer Verantwortung und mit 4,9 Prozent wird daraus nichts.
Was nun zu tun ist – Roadmap bis 2029
Die Landtagswahl im Saarland ist gelaufen. Die kommenden Landtagswahlen sind im Mai in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. In Schleswig-Holstein wurden wir zuletzt nicht einmal mehr als Partei gesondert ausgewiesen, sondern unter »Sonstige Parteien«, die zwischen Nord- und Ostsee dadurch auf einen Wert von 8 Prozent kommen, subsummiert.
Sechs Wochen nach der Landtagswahl Nordrhein-Westfalen treten wir zum Erfurter Bundesparteitag zusammen. Würde es wie immer laufen, endete der Parteitag im besten Fall mit einigen politisch Verletzten – im schlechten Fall als verbale Massenschlägerei und Beschleunigung der negativen Spirale. Verlieren würden am Ende alle.
Es ginge aber auch anders:
- Gestalten wir den Parteitag als sichtbares Signal einer neuen linken Hausordnung, die zeigt, wie wir uns im Parteihaus DIE LINKE künftig begegnen werden:
- Heterogenität: Eine plurale Linke, die gesellschaftspolitisch für Vielfalt eintritt, akzeptiert auch und gerade in sich selbst Heterogenität. Gleichzeitig sehen wir die damit verbundenen Herausforderungen. Gerade innerhalb linker Organisationen, die ständig gegen gesellschaftliche Widerstände kämpfen, wird Pluralität und Vielfalt auch als Hemmnis, Ärgernis, Rückschritt auf dem Weg zum Fortschritt wahrgenommen. Heterogenität als Selbstverständlichkeit, im besten Falle sogar als Chance, zu sehen, setzt deshalb immer aufs Neue ein reflektiertes, akzeptierendes Denken voraus.
- Aktive und solidarische Diskurskultur: Angesichts abnehmender gesellschaftlicher Bindungskräfte und diskursiver Verrohung - insbesondere in den sozialen Netzwerken – treten wir als DIE LINKE durch eine aktive und spürbare solidarische Diskurskultur auf.
- Alle dürfen sprechen: Aktive und solidarische Diskurskultur setzt voraus und beinhaltet, dass grundsätzlich alle sprechen dürfen. Man muss nicht die Debatte über »Wokeness« bemühen, um zumindest darauf hinzuweisen, dass eine heterogen zusammengesetzte Partei unterschiedlich spricht und Genoss*innen unterschiedlichen Alters und verschiedener Sozialisation sowie Herkunft auch dann überzeugte Antirassist*innen sind, wenn sie (noch) mit dem Begriff »Fremdenfeindlichkeit« operieren, weil sie die Debatte um die sinnvolle Nichtverwendung des Begriffs nicht verfolgt haben bzw. auch dann überzeugt für die Gleichstellung aller Lebensweisen sind, wenn ihnen nicht klar ist, was »FLINT*«-Personen sind. Eine Partei die Arbeiter*innen ebenso wie Akademiker*innen, Schüler*innen, Migrant*innen, Alte und Junge, Menschen unterschiedlicher Geschlechter zusammenbringen will muss akzeptieren, dass Menschen unterschiedlich denken, sprechen, handeln. Gleichzeitig muss jede geäußerte Position sich auch Widerspruch stellen – in einer solidarischen Diskurskultur.
- Vorbildwirkung der Repräsentant*innen: Die Repräsentant*innen der Partei, Mandatsträger*innen in Parlamenten oder Regierungen müssen als Vorbilder einer solidarischen Diskurskultur erkennbar sein. Wir profilieren uns durch Einheit in der Vielfalt, nicht durch Beschimpfung der Partei. Das betrifft uns alle –mich als Autor dieses Papiers genauso wie diejenigen, die Säle füllen und Bücher publizieren, die insbesondere von der medial verstärkten öffentlichen Infragestellung der eigenen Partei und ihrer Beschlüsse leben.
- Pluralismus ist nicht Beliebigkeit: Eine Partei lebt davon, dass sie sich durch Debatte verständigt und Forderungen in Form von Beschlüssen formuliert. Diese umzusetzen ist wiederum Aufgabe in gesellschaftlicher und parlamentarischer Opposition oder in Regierungsverantwortung. Das Ringen um Beschlüsse in Form von Mehrheiten und Minderheiten macht eine Partei attraktiv. Minderheitenpositionen zu artikulieren in solidarischer Diskurskultur bedeutet die Mehrheit zu akzeptieren und um Mehrheiten im innerparteilichen Diskurs zu ringen.
- Solidarische Fehler- und Lernkultur: Fehler und Niederlagen sind die natürlichen Begleiterscheinungen aktiven Handelns. Wer Verantwortung übernimmt, muss auch für Fehler geradestehen. Gleichzeitig bedeutet eine solidarische Fehler- und Lernkultur Fehler und Niederlagen zu analysieren, um daraus zu lernen, statt immer gleich Rücktritte zu fordern.
- Jede Organisation hat Rituale und Traditionen. Hierzu gehört in unserer Partei der Leitantrag auf einem Bundesparteitag. Er bemüht sich zumeist um die komplexe Erklärung der jeweils aktuellen ebenfalls komplexen innen- und außenpolitischen Weltlage. Daraufhin werden in einer schwer überschaubaren Menge an Änderungsanträgen, die in Form von Halbsätzen, Ersetzen einzelner Wörter, Einfügung und Streichung ganzer Absätze Veränderungen am Leitantrag vorgenommen, der dann nach seiner Beschlussfassung von niemandem weiter genutzt wird.
Angesichts der Zeitenwende, die durch den Angriffskrieg Putins auf die Ukraine eingetreten ist, ebenso wie durch die Ankündigung der Ampelkoalition nicht nur 100 Milliarden Euro für ein Bundeswehr-Sondervermögen auszugeben, sondern das Grundgesetz zu ändern, um zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Aufrüstung auszugeben, sollten wir prüfen, ob das Modell »Leitantrag« noch angemessen ist. Ich meine Nein. Er trägt weder zur Klarheit noch zur Erkennbarkeit bei. Aufwand und Ertrag sind unverhältnismäßig.
Ich plädiere dafür, dass zu den drei, vier wesentlichen gesellschaftlich relevanten Fragen, zu denen wir uns als Partei verständigen müssen, zentrale Anträge vorliegen. Darüber diskutieren wir dann – vor und auf dem Parteitag. Und wir treffen Entscheidungen als Friedens- und als Gerechtigkeitspartei.
Dies wird bei der Verurteilung des Angriffskriegs von Putin selbstverständlich sein. Bei der Ablehnung der neuen Aufrüstung werden wir ebenfalls unsere Gemeinsamkeiten erkennen.
Und dort, wo wir offene Fragen haben – wie muss eine neue Entspannungspolitik aussehen? Wie kann ein kollektives europäisches Sicherheitssystem entstehen? Wie gestaltet sich unser Verhältnis zur Bundeswehr und zu den Staatsbürger*innen in Uniform? – legen wir im besten Falle ein Verfahren zur transparenten und solidarischen Debatte fest. Einen Vorschlag habe ich unterbreitet.
Vom Parteitag sollte ein klares Signal ausgehen, wie wir als Gerechtigkeitspartei im oben dargestellten Sinne, angesichts der Energiepreiskrise einerseits und der Klimakrise andererseits, sozial-gerechte Klima- und Energiepolitik gestalten wollen und werden – gesellschaftlich, parlamentarisch, im Bundesrat in dem wir in vier von sechzehn Ländern Gestaltungsverantwortung tragen und mitentscheiden über wesentliche Vorhaben.
Nach dem Bundesparteitag steht im Herbst die Landtagswahl in Niedersachsen an. Dort wollen wir besser dastehen, als wir es derzeit tun.
Im kommenden Jahr streben wir die Fortsetzung der rot-grün-roten Regierung in Bremen an und wollen weitere vier Jahre erfolgreiche linke Stadtpolitik gestalten. In den hessischen Landtag wollen wir erneut einziehen, um zu zeigen – in Stadt und Land ist linke Politik nötig.
Übernächstes Jahr finden in vielen Ländern Kommunalwahlen statt und das Europaparlament wird gewählt. Bis dahin sollten wir zeigen, dass wir als pro-europäische linke Partei stärker werden können und wollen, als wir es heute sind. Mit dem Rückenwind dieser Wahlen starten wir in die drei ostdeutschen Landtagswahlen Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Stärker werden als 2019 und erneut in Thüringen den Ministerpräsidenten zu stellen – so lauten unsere Ziele für 2024.
Und auf dieser Grundlage starten wir dann in das Bundestagswahljahr 2025, bei dem wir gern wieder drei und mehr Direktmandate erhalten aber die Fünf-Prozent für uns keine Hürde mehr sind, weil wir aufgestanden sind und es besser gemacht haben als bislang.
Das ist die erste Etappe. Danach beginnt die zweite Etappe, die bis 2029 reicht. Über die zweite Etappe sollten wir uns dann auseinandersetzen, wenn wir die erste Etappe erfolgreich begonnen haben.
»Keine Atempause! Geschichte wird gemacht!«