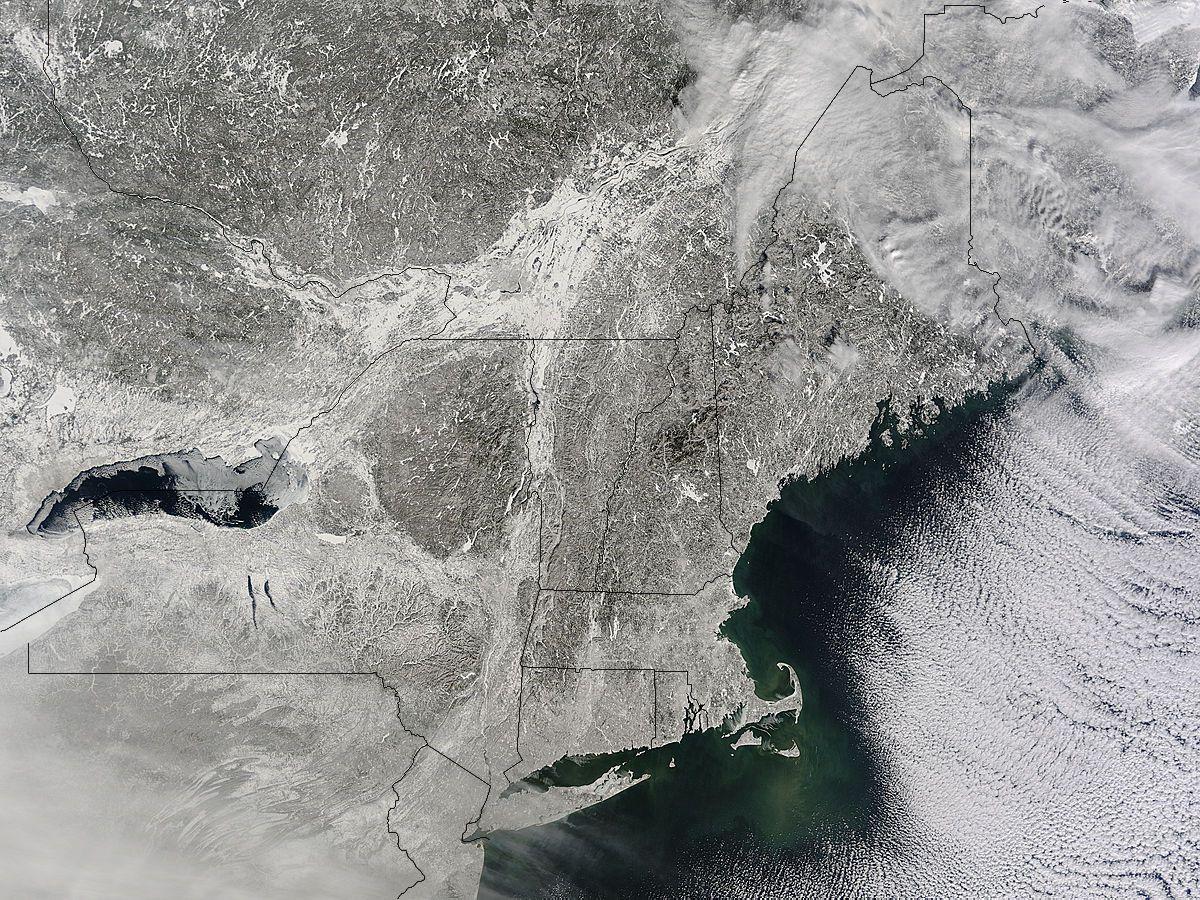Gewöhnlich behandeln PolitikerInnen die wachsende Ungleichheit und den schleppenden Wiederaufschwung als separate Phänomene, obwohl sie miteinander verflochten sind. Soziale Ungleichheit erstickt Wachstum. Wenn sogar das marktliberale Magazin The Economist (Sonderausgabe 10/2012) erklärt, welche ernst zu nehmende Gefahr vom Ausmaß und dem Charakter der Ungleichheit ausgeht, dann muss etwas ziemlich schief gelaufen sein. Trotzdem haben wir auch nach vier Jahrzehnten wachsender Ungleichheit und dem größten Abschwung seit der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre nichts dagegen unternommen.
Es gibt vier Hauptursachen dafür, dass die Ungleichheit den Wiederaufschwung erstickt. Die unmittelbarste ist, dass die Mittelklasse zu schwach ist, um das Konsumniveau aufrechtzuerhalten, das in der Vergangenheit das Wirtschaftswachstum angetrieben hat. Das oberste eine Prozent der Verdienenden konnte 93 Prozent der Einkommenszuwächse einstreichen, während die Mittelklassehaushalte im letzten Jahr inflationsbereinigt über geringere Einkommen verfügten als im Jahr 1996. Es sind diese Haushalte, die ihre Einkommen tendenziell ausgeben statt sie zu sparen. Sie sind somit die wahren Erschaffer von Arbeitsplätzen. Das Wachstum des Jahrzehnts vor der Krise war nicht aufrechtzuerhalten – es gründete darauf, dass die unteren 80 Prozent der Bevölkerung jährlich ungefähr 110 Prozent ihres Einkommens konsumierten – also auf Pump lebten.
Zweitens wurde die Mittelklasse seit den 1970er Jahren finanziell immer weiter belastet (mit einer kurzen Ausnahme in den 1990ern). Sie konnte nicht ausreichend in ihre Zukunft investieren, weder in Form von Bildung für sich und ihre Kinder, noch durch die Gründung oder Vergrößerung von Unternehmen.
Drittens sinken durch die Schwäche der Mittelklasse die Steuereinnahmen, insbesondere weil sich die Oberschicht so gut darauf versteht, Steuern zu umgehen und Washington zu Steuererleichterungen zu bewegen. Die kürzlich beschlossene Erhöhung des Einkommensteuersatzes für Einzelpersonen, die über 400 000 Dollar im Jahr verdienen, und Haushalte, die mehr als 450 000 Dollar zur Verfügung haben, auf das Niveau der Clinton-Zeit hat an dieser Tatsache nichts geändert. Gewinne aus Börsenspekulationen werden deutlich geringer besteuert als andere Formen von Einkünften. Wegen des niedrigen Steueraufkommens kann die Regierung nicht die Mittel für Investitionen in Infrastruktur, Bildung, Forschung und Gesundheit leisten, die für einen langfristigen Wiederaufschwung unabdingbar wären.
Viertens geht größere Ungleichheit mit häufigeren und heftigeren Boom- und Krisen-Zyklen einher. Sie machen unsere Wirtschaft instabiler und krisenanfälliger. Obwohl die Krise nicht unmittelbar durch die Ungleichheit verursacht wurde, so ist es doch kein Zufall, dass die 1920er Jahre – als die Einkommensdisparität und die Reichtumsunterschiede in den USA das letzte Mal so groß waren wie heute – in einen Börsenkrach und die Weltwirtschaftskrise mündeten. Der Internationale Währungsfonds hat auf die systematische Beziehung zwischen wirtschaftlicher Instabilität und wirtschaftlicher Ungleichheit hingewiesen, aber die amerikanische Führung scheint diese Lektion nicht gelernt zu haben.
Die zunehmende Ungleichheit steht in krassem Gegensatz zu den meritokratischen Idealen eines Amerika, in dem jeder »es schaffen kann«, wenn er nur hart arbeitet und Talent hat. Sie nimmt Kindern aus einkommmensschwachen Familien die Möglichkeit, ihre Potenziale zu entfalten. In anderen reichen Ländern wie z.B. Kanada, Frankreich, Deutschland und Schweden haben Kinder im Verhältnis zu den USA größere Chancen, erfolgreicher zu sein als ihre Eltern. Mehr als ein Fünftel unserer Kinder lebt in Armut – das ist der zweitschlechteste Wert aller entwickelten Volkswirtschaften, schlechter als Bulgarien, Litauen oder Griechenland.
Unsere Gesellschaft verschwendet ihre wertvollste Ressource: unsere Jugend. Der Traum von einem besseren Leben, der Generationen von ImmigrantInnen in unser Land lockte, wird durch die wachsende Schere zwischen arm und reich zunichte gemacht. Tocqueville, der in den 1830er Jahren den egalitären Impuls als wichtigstes Merkmal Amerikas ansah, würde sich im Grabe umdrehen.
Selbst wenn wir den ökonomischen Imperativ zur Behebung der Ungleichheit ignorieren könnten, wären allein die Folgeschä- den für unser soziales Gefüge und das politische Leben Anlass genug zur Sorge. Ökonomische Ungleichheit führt zu politischer Ungleichheit und zu einem dysfunktionalen demokratischen Prozess. Ungeachtet der Beteuerungen Obamas, allen AmerikanerInnen helfen zu wollen, machten die Rezession und die Folgen der Krisenbewältigung alles noch viel schlimmer. Während 2009 riesige Summen für die Bankenrettung ausgegeben wurden, stieg die Arbeitslosigkeit im Oktober desselben Jahres auf zehn Prozent an. Die heutige Quote von 7,8 Prozent scheint zunächst besser, lässt sich jedoch vor allem auf die Tatsache zurückführen, dass viele Menschen aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind, nie Teil davon waren oder Teilzeitstellen angenommen haben, da sie keine Vollzeitbeschäftigung finden konnten. Eine hohe Arbeitslosigkeit drückt natürlich das Lohnniveau. Die inflationsbereinigten Reallöhne stagnieren oder sind gesunken. Das durchschnittliche Einkommen eines männlichen Arbeiters war im Jahr 2011 (mit 32 986 Dollar) geringer als etwa 1968 (33 880 Dollar). Im Gegenzug haben die sinkenden Steuereinnahmen zu gesamtstaatlichen und lokalen Kürzungen bei Leistungen geführt, die gerade für die mittleren und unteren Einkommensgruppen entscheidend sind.
Der größte Vermögenswert der meisten US-AmerikanerInnen ist ihr Eigenheim. Mit dem dramatischen Preisverfall für Immobilien sanken folglich auch die Vermögen der Haushalte – insbesondere, da so viele Menschen so hohe Kredite für ihre Häuser und Wohnungen aufgenommen hatten. Der Nettowert des Vermögens vieler Haushalte nahm ab: Das durchschnittliche Vermögen eines Haushalts fiel um fast 40 Prozent von 126 400 Dollar im Jahr 2007 auf 77 300 Dollar im Jahr 2010 und erholte sich seitdem nur leicht. Seit Beginn der Krise 2007 ging der größte Teil des Zuwachses des gesamtgesellschaftlichen Reichtums an die Reichsten.
Während die Einkommen stagnierten oder sanken, schnellten die Studiengebühren in die Höhe. In den USA führt der Weg zu höherer Bildung – der einzigen sicheren Möglichkeit sozialen Aufstiegs – in die Verschuldung. Die Schuldenlast von Studienkrediten, die sich derzeit auf insgesamt eine Billion Dollar beläuft, übertraf 2010 zum ersten Mal die Gesamtverschuldung durch Kreditkarten. Schulden aus Studienkrediten erlöschen quasi nie, nicht einmal bei Zahlungsunfähigkeit oder wenn das Kind verstirbt, für das die Eltern einen Studienkredit aufgenommen hatten. Die (Hoch-) Schulen sind von Profitstreben zugunsten ausbeuterischer Investoren getrieben. Die Studienkreditschulden werden auch dann nicht erlassen, wenn Hochschulen eine unangemessene Ausbildung anbieten, die Studierenden mit irreführenden Versprechungen ködern und die Ausbildung nicht zu einem entsprechenden Anstellungsverhältnis führt.
Statt Banken mit Geld zu überhäufen, hätten wir versuchen können, unsere Wirtschaft von unten her wieder aufzubauen. EigenheimbesitzerInnen, deren Schuldenlast höher ist als der Wert ihres Hauses, hätte ein Neuanfang gewährt werden können, indem die Wertminderungen durch entsprechende Teilabschreibungen der Kredite ermäßigt worden wären. Den Banken hätten im Gegenzug Anteile an den Gewinnen in Aussicht gestellt werden können, sollten sich die Immobilienpreise wieder erholen. Obama hat die Banken gerettet, aber nicht ausreichend in die ArbeiterInnen und Studierenden investiert. Wir hätten erkennen können, dass die Fähigkeiten junger Menschen verkümmern, wenn sie arbeitslos sind. Wir hätten sicherstellen können, dass sie sich alle entweder in der Schule, der Universität, einer Ausbildung oder in Arbeitsverhältnissen befinden. Stattdessen haben wir zugelassen, dass die Jugendarbeitslosigkeit auf das Doppelte der landesweiten Gesamtarbeitslosigkeit angestiegen ist. Die Kinder der Reichen können die Schule beenden und die Universität besuchen, ohne sich ungeheure Schuldenlasten aufzuladen oder ihre Lebensläufe mit unbezahlten Praktika aufzupeppen. Junge Menschen aus mittleren oder ärmeren Verhältnissen können das nicht. Wir säen die Saat künftiger Ungleichheit.
Die Regierung Obama trägt natürlich nicht allein die Schuld. Die drastischen Steuersenkungen 2001 und 2003 unter Präsident George W. Bush und seine Billionen verschlingenden Kriege im Irak und in Afghanistan haben das Sparschwein geschlachtet und die soziale Kluft vertieft. Die neu ausgerufene Haushaltsdisziplin seiner Partei – die nicht mehr ist, als das Beharren auf niedrigen Steuern für die Reichen und Kürzungen bei den Leistungen für die Armen – ist der Gipfel der Scheinheiligkeit. Es gibt allerhand Entschuldigungen für wirtschaftliche Ungleichheit. Manche behaupten, wir könnten sie nicht beeinflussen und verweisen auf die »Kräfte des Marktes«, auf Globalisierung, Handelsliberalisierung und technologische Neuerungen oder auf den »Aufstieg des Rests der Welt«. Andere versichern, ein Eingreifen in diesen Kreislauf würden uns alle zu Verlierern machen, weil es unseren jetzt schon stotternden ökonomischen Motor abwürgen würde. All das sind eigennützige, ignorante Unwahrheiten.
Die Kräfte des Marktes existieren nicht in einem Vakuum – wir gestalten die Rahmenbedingungen. Andere Länder, wie das schnell wachsende Brasilien, haben die Bedingungen so gestaltet, dass sie ökonomische Ungleichheit reduzieren und gleichzeitig mehr Möglichkeiten und größeres Wachstum schaffen. Länder, die weitaus ärmer sind als wir, haben beschlossen, dass alle jungen Menschen Zugang zu Nahrung, Bildung und Gesundheitsversorgung bekommen sollten, damit sie ihre Hoffnungen erfüllen können. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen in den USA und die Art und Weise, wie sie umgesetzt werden, haben ebenfalls Spielräume geschaffen – allerdings vor allem für Missbrauch im Finanzsektor, für absurde Abfindungen von Spitzenmanagern oder für Monopolisten, die ihre konzentrierte Macht unrechtmäßig ausnutzen.
Ja, der Markt wertet manche Fähigkeiten höher als andere und diejenigen, die solche Fähigkeiten haben, werden erfolgreich sein. Ja, Globalisierung und technologischer Fortschritt haben zum Verlust von Facharbeiterstellen in der Produktion geführt, die hier wahrscheinlich auch nicht wieder entstehen werden. Die Beschäftigungszahlen in der Produktion sinken weltweit, schon allein durch die enorme Produktivitätssteigerung. Und wahrscheinlich wird nur ein schrumpfender Anteil der insgesamt sinkenden Zahl neuer gewerblicher Arbeitsplätze in den USA entstehen. Selbst eine »Rettung« dieser Arbeitsplätze würde vor allem darin bestehen, besser bezahlte Arbeit in schlechter bezahlte Arbeit zu verwandeln – wohl kaum eine längerfristige Perspektive.
Die Globalisierung und die unausgeglichene Art und Weise, in der sie vorangetrieben wurde, hat die Verhandlungsmacht der ArbeiterInnen geschwächt: Firmen können mit Standortverlagerungen drohen – besonders wenn die Steuergesetzgebung Investitionen im Ausland begünstigt. Dies hat die Gewerkschaften geschwächt. Und obwohl Gewerkschaften manchmal auch zu Rigidität beitragen, so verfügen doch die Länder, die am erfolgreichsten auf die Krise reagierten, wie Deutschland oder Schweden, über starke Gewerkschaften und starke soziale Sicherungssysteme. Zu Beginn der zweiten Amtszeit Obamas müssen wir daher alle anerkennen, dass unser Land sich nicht schnell und nachhaltig von der Krise erholen kann, ohne wirksame Maßnahmen gegen die Ungleichheit zu ergreifen. Wir brauchen eine umfassende Antwort, die zumindest breite Investitionen in Bildung, ein stärker gestaffeltes Steuersystem und eine Besteuerung von Spekulationsgewinnen beinhalten sollte.
Die gute Nachricht ist, dass sich unser Denken gewandelt hat: Früher haben wir gefragt, wie viel Wachstum wir für ein bisschen mehr Gleichheit und Chancengleichheit zu opfern bereit wären. Mittlerweile erkennen wir den hohen Preis, den wir für unsere Ungleichheit zahlen. Wir sehen, dass die Verringerung sozialer Ungleichheit und die Förderung wirtschaftlichen Wachstums zusammenhängen, komplementäre Ziele sind. Es liegt an uns allen – unsere politische Führung inbegriffen –, den Mut und Weitblick aufzubringen, dieses erdrückende Elend endlich zu lindern.
Aus dem Amerikanischen von Tashy Endres. Der Text erschien zuerst auf http://opinionator. blogs.nytimes.com/2013/01/19.
Auf diesen Beitrag reagiert
Paul Krugman, Keynesianer, Wirtschaftsnobelpreisträger und regelmäßiger Kolumnist der New York Times.