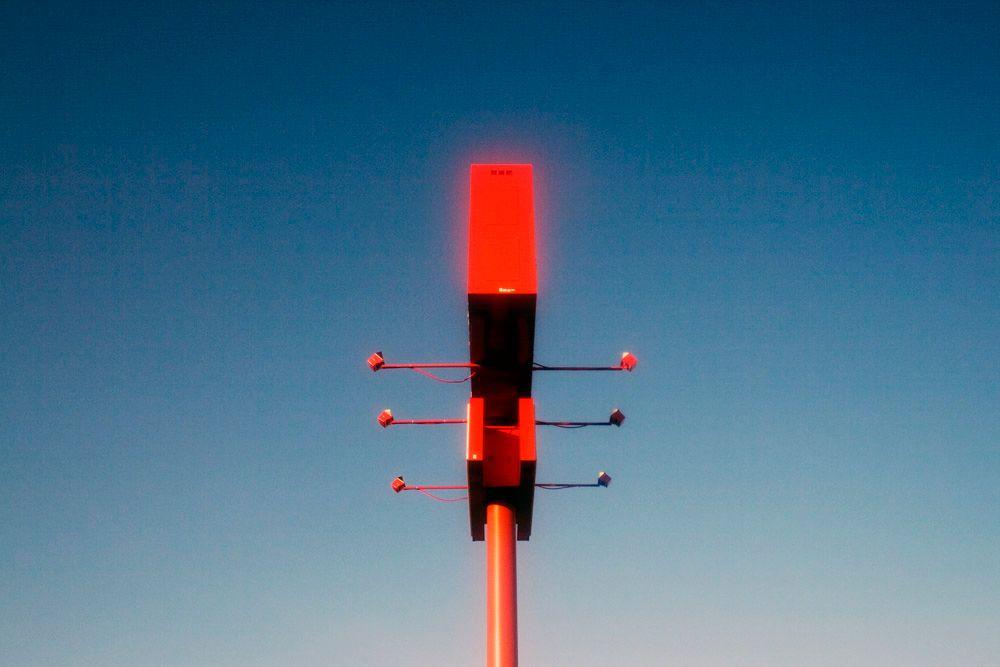Du befasst dich mit dem fast religiösen Glauben der Menschen an den Markt. Dieser soll nun auch persönliche Probleme lösen, obwohl er immer wieder versagt. Warum machen sich die Menschen vom Markt so abhängig?
Wir leben nicht mehr in den sozialen Gefügen von früher. Und in den USA verfügen wir auch nicht über ein System öffentlicher Dienstleistungen, wie es in Europa besteht. Also wenden wir uns dem Markt zu. Wir erleben, dass private Dienstleister unser Leben verbessern. Und es entsteht das Gefühl, dass wir sie brauchen, um das »optimale« Privatleben zu haben.
Aktuell gibt es einige bedrohliche Entwicklungen: Soziale Infrastrukturen werden geringgeschätzt, und es wird ihnen die Finanzierung entzogen. Der gemeinnützige Sektor ähnelt immer stärker dem privaten und eine wachsende Spaltung zwischen Arm und Reich sorgt für Statusunsicherheit. Das Dienstleistungsangebot weitet sich aus und bietet Antworten auf private Probleme – sowohl echte als auch Scheinantworten – und auch Antworten auf Probleme, die der Markt überhaupt erst geschaffen hat.
Du verweist auf eine Paradoxie: Der Markt untergräbt Stabilität, schafft Verunsicherung; und dann wird plötzlich Schutz vor genau dieser Verunsicherung über den Markt angeboten.
Ja, das ist ein merkwürdiges Nehmen und Geben. Ein Beispiel: Wir alle benutzen Handys oder Smartphones. Neulich versuchte ich auf der Straße mit irgendjemandem aus meiner Nachbarschaft Kontakt aufzunehmen. Alle waren mit ihren Handys zugange. Im Park, im Café – nach einer Weile schaute auch ich auf mein Handy. Es war nicht möglich, jemandem per Kopfnicken auch nur einen »guten Morgen« zu wünschen oder zumindest hätte es völlig unzeitgemäß gewirkt. Wäre ich neu in der Gegend und auf der Suche nach Bekanntschaften, hätte ich einfach Pech – wegen dieser »Techno-Anomie«.
Der Markt hat aber eine Antwort auf dieses Problem: socialjane.com – eine kommerzielle Vermittlungsagentur für platonische Freundschaften. Man trägt sich ein, bezahlt und schaut sich die Profile potenzieller Freunde an. Socialjane.com verspricht eine gute »Rendite« hinsichtlich der ins Freunde-Finden investierten Zeit und des Geldes. Die Website versichert, dass alle ihre Nutzer »ernsthaft« nach Freunden suchen. Warum? Weil alle dafür bezahlt haben. Man bezahlt also nicht nur Geld, um Freunde zu finden, sondern denkt auch über Freundschaft in einer kommerzielleren Weise nach. So erliegt man dem Zauber des Marktes. Das ist paradigmatisch für eine umfassendere Entwicklung in den USA.
Und wie fügt sich die Klassenfrage in das Bild des ausgelagerten Selbst?
Sowohl auf der Ebene der Fakten als auch auf der des Imaginären: Ich habe über 1000 Menschen in Kalifornien befragt. Erschreckend waren die Antworten auf die Frage: »Hätten Sie prinzipiell Interesse daran, Dienste eines Liebes-Coaches, eines Partyorganisators oder einer Person, die Familienfotos in ein Album klebt, in Anspruch zu nehmen?« Ich dachte eigentlich, dass solche Dienstleistungen eher den Bedürfnissen der Mittelklasse entsprechen. Aber es waren vor allem Befragte mit niedrigen Einkommen, die sich das vorstellen konnten. Sie stimmten auch in höherem Maße der Aussage zu: »Wenn man etwas braucht, kann man sich nicht immer auf die eigene Familie oder auf Freunde verlassen, auf Geld hingegen schon.«
Die Armen haben weder Geld, noch verfügen sie über funktionierende Netzwerke, die ihnen durch gute und schlechte Zeiten helfen. Garantiert man einfach nur allen einen gleichen Zugang zum Markt, ist das Problem, dass diese Menschen von der Gesellschaft keine Unterstützung erfahren, nicht gelöst.
In deinem Buch schreibst du, dass das Wohlbefinden von Familien möglicherweise davon abhängt, inwiefern es ihnen gelingt, Unmittelbares in ihr marktvermitteltes Leben zurückzuholen. Siehst du hier eine Lösung?
Ja. Wir ziehen ständig Grenzen: Auf der einen Seite steht die »richtige Menge« emotionalen Involviertseins, auf der anderen fühlen wir uns zu entfremdet. In dem Kapitel über Partnersuche schreibe ich über eine Frau namens Grace, die einen Liebes-Coach anheuerte. Er sollte ihr helfen, über eine Online-Agentur einen Mann zu finden. Der Coach gibt ihr viele Ratschläge, die sie über ihre Grenzen nachdenken lassen. Er sagt: »Partnersuche ist wie Arbeitssuche. Man muss ausreichend Zeit aufwenden. Du musst dir ein Markenzeichen für deine Person ausdenken! Du bist im weltgrößten Einkaufszentrum für Liebesbeziehungen, und als 49-Jährige bist du auf einer Attraktivitäts-Skala von eins bis zehn wahrscheinlich bei sechs.« Sie schluckt, aber sagt »okay«. Grace hat eine lange Einkaufsliste: Ihr Wunschpartner soll groß sein, ein Ingenieur oder ähnliches, zwischen 40 und 50, emotional gereift usw. Der Coach rät ihr, den gewünschten Ertrag im Verhältnis zur Investition zu kalkulieren. Er hilft ihr, mit dem Markt zurechtzukommen, also marktförmig über ihr Privatleben nachzudenken. Seine Ratschläge scheinen für sie eigentlich auf der richtigen Seite der Grenze zu liegen. Aber dann beginnt sie eine Beziehung mit dem falschen Kandidaten. Ein halbes Jahr später trennen sich die beiden. Zum Abschied sagt er zu ihr: »Du warst so leicht zu finden. Ich gehe einfach wieder auf Match.com und finde jemanden, der genauso ist wie du.« Rückblickend äußert Grace: »Das war eine Grenzüberschreitung. Es hörte sich an, als sei ich eine Cornflakes-Schachtel im Supermarktregal. Nun will er noch mal zum Laden gehen und eine andere Packung kaufen.«
Der Mann nutzte den Markt nicht nur als Mittel, um ein nicht-marktförmiges Ziel zu erreichen. Er ging den Weg konsequent zu Ende und sah auch Grace durch eine marktförmige Brille. Also zog Grace eine neue Grenze – sie wollte, dass sich ihr persönliches Leben weiterhin persönlich anfühlte. In gewisser Weise half der Trainer ihr sogar, das Gefühl von Entfremdung zu vermeiden.
Du schreibst auch über die Situation von Leihmüttern in Indien. Amerikanerinnen lassen dort ihre Kinder austragen.
Die indischen Frauen, die ich getroffen habe, waren großartig – sehr reflektiert – und sie befanden sich in fürchterlichen Lebenssituationen. Sie bieten ihre Gebärmutter an, um Babies auszutragen, die genetisch von anderen Eltern abstammen (vgl. Wichterich in diesem Heft). Die Direktorin der Ashanksha-Klinik brüstete sich damit, den größten Leihmütter-Dienst der Welt zu leiten. Und sie leitet ihn wie eine Fabrik. Will sie die Produktion ausweiten, beauftragt sie Scouts damit, weiter Leihmütter anzuheuern. Zur Qualitätskontrolle verpflichtet sie die Leihmütter, in Schlafräumen zu übernachten; im Achtbettzimmer, neun Monate lang. Sie dürfen nicht mit ihren Ehemännern schlafen, damit sie sich keine Krankheiten holen. Im Sinne einer Effizienzsteigerung hielt sie die Leihmütter an, ihre Gebärmütter lediglich als Behälter zu sehen. Meist wissen sie nicht, wo ihre Kundinnen leben, wie sie heißen, und wenn sie mit ihnen sprechen, so ist es jeweils nur sehr kurz.
In der Sprache der Direktorin handelte es sich hier um ein echtes Win-win-Geschäft zwischen unfruchtbaren Paaren und Leihmüttern mit finanziellen Sorgen. Sicherlich haben beide Seiten etwas davon: Die Leihmutter bekommt dringend benötigtes Geld – das Paar das lang ersehnte Baby. Aber diese Perspektive verdeckt andere, intime Sichtweisen auf den Prozess des Gebärens und auf das Leben als ultimatives Geschenk. In diesem Bild gibt es nur ein »Ich«, aber kein »Wir«.
Ein in dieser Situation fehlendes »Wir« ist der Staat. Der Bundesstaat Gujarat bietet den Armen quasi kein soziales Netz, auf das sie zurückgreifen könnten. Wie auch in den anderen Teilen Indiens ist das öffentliche Gesundheitswesen in einem grauenhaften Zustand. Weniger als zehn Prozent der schwangeren Frauen haben Zugang zu Vorsorgeuntersuchungen. In dem Dorf, das ich besucht habe, gab es weder asphaltierte Straßen noch Laternen. Es gab überhaupt keine öffentliche Infrastruktur. Für mich ist das die versteckte Dystopie, die mit der ganzen Frage des Outsourcings einher geht.
Heutzutage wird uns Angst vor dem Staat gemacht: Er wird als »Big Brother« dargestellt. In 1984 von George Orwell, in Schöne Neue Welt von Aldous Huxley, im Report der Magd von Margaret Atwood ist der Staat diese riesige, feindliche Dampfwalze, die es auf uns abgesehen hat. Aber in großen Teilen Indiens gibt es keine öffentlichen Dienstleistungen. Der Staat tut für den Einzelnen gar nichts; man trifft »freie Entscheidungen«, ohne dass es irgendeine Form der Unterstützung gibt. Das ist wirklich gespenstisch; die große Dampfwalze besteht in Wirklichkeit darin, dass es zwischen dem Individuum und dem Markt keine Instanz gibt. Der Markt funktioniert folglich nach dem Prinzip »friss oder stirb«. Und dennoch bedienen sich die indischen Leihmütter, mit denen ich geredet habe, der Sprache der Geschäftswelt – sie sagen: »Ich habe das selbst entschieden.« Wofür sie sich allerdings nicht selbst entschieden haben, ist das Versorgungsvakuum, innerhalb dessen sie ihre Wahl trafen.
Geht diese Situation mit psychischen Kosten für die Leihmütter einher?
Natürlich. Eine Leihmutter war Hindu, aber sie wurde von einem Sikh-Paar dafür bezahlt, ein Kind auszutragen. Das Paar erwartete von ihr, jeden Tag in den Sikh-Tempel zu gehen, um den Fötus der Rezitation von Sikh-Texten auszusetzen. Das Paar stellte sogar eine Bedienstete an, die der Leihmutter helfen, aber eben auch sicherstellen sollte, dass sie täglich in den Tempel ging. Es war, als ob die Leihmutter einen Beutel Gold verschluckt hatte, der dem Sikh-Paar gehörte. Auch sie zog eine Grenze und sagte für das Baby heimlich hinduistische Gebete auf.
Das soziale Netz in den USA ist nicht so dicht wie in Europa oder gar in Skandinavien. Kommt es in Europa seltener zu solchen Outsourcing-Prozessen?
Die USA, Deutschland, Schweden, Italien – das sind alles kapitalistische Länder mit Dienstleistungssektoren, die unterschiedliche personenbezogene Dienstleistungen anbieten. Die USA unterscheiden sich hier in dreierlei Hinsicht: in der Masse der angebotenen Dienstleistungen; darin, dass es kaum einen öffentlichen Dienstleistungssektor gibt; und in der stärker ausgeprägten Marktkultur.
In den Reaktionen auf mein Buch lassen sich diese Unterschiede schön sehen: Wenn ich in den USA Vorträge halte, reagieren die Leute oft nachdenklich oder besorgt – als ob ich eine Dienstleistung kritisieren wollte, die ihnen emotional wichtig ist, oder gar, als ob ich ihnen diese wegnehmen wollte. Wenn ich denselben Vortrag in Italien oder Dänemark halte, kichern die Leute. Ich muss dann erklären, dass ich mich nicht über andere lustig mache und auch keinen Witz erzähle. Das finden sie dann wieder lustig. Schließlich sagen sie: »Wahrscheinlich wird all das irgendwann auch zu uns kommen.« Sie sind es gewöhnt, nach Amerika zu schauen und zu denken: »Oh Gott, in 20 Jahren passiert das auch hier.«
An anderer Stelle schreibst du, dass die Leute eher Geld für Partnervermittlungen zahlen, wenn sie glauben, dass »wissenschaftliche Methoden« dahinter stecken.
Das ist wahr. Ich habe den Chef des Forschungslabors der Vermittlungsagentur eHarmony interviewt. Er erzählte, dass sie jetzt auf internationaler Ebene agierten und ein Forschungslabor für Beziehungen unterhalten – und dass er den Bereich der Liebesforschung ausdehnen wolle. eHarmony verfügt über zahlreiche Forschungsergebnisse zum Thema »soziale Ähnlichkeiten«. Je ähnlicher sich zwei Menschen sind, so der Gedanke, desto besser passen sie zusammen. Was damit aber noch nicht beantworten werden kann, ist die Frage, wie es eigentlich passiert, dass »ein Funke überspringt«. Um in dieser Frage der »Chemie« weiter zu kommen, planen sie, Speichelproben zu entnehmen und DNA zu untersuchen. Sie streben so verlässliche Vorhersagen hinsichtlich des Vermittlungserfolgs an.
Match.com, eHarmony und andere stehen miteinander in Konkurrenz, wer die meisten Dates, Dauerbeziehungen und Ehen hervorbringt. Zu Werbezwecken veröffentlichen sie ihre entsprechenden Zahlen. Außerdem stehen sie aber auch in Konkurrenz mit dem wirklichen Leben – sie argumentieren, dass es wahrscheinlicher ist, eine besondere Person zu treffen, wenn man eine Firma beauftragt, als wenn man sich im Büro oder auf Partys umschaut. Ich frage mich, was das für Folgen für die Lebendigkeit unserer Gesellschaft hat.
Du sagst, wir hätten aufgehört, uns als Teil von »etwas Größerem« zu fühlen. Was macht dieses »Größere« aus? Und ist es durch Outsourcing gefährdet?
Ja. Es geht etwa um das Gefühl, Teil einer fortschrittlichen Bewegung für gesellschaftliche Veränderung zu sein – der Umweltbewegung, einer Bewegung für die Erneuerung der Städte, einer Bewegung für Erneuerung im Bildungswesen. Leute, die ehrenamtlich in einem Recycling-Center oder in einer Suppenküche tätig sind, die einer Kirche oder einer Nachbarschaftsgruppe angehören, können sich als Teil von »etwas Größerem« fühlen. Dieses Gefühl der Zugehörigkeit ruft einen anderen Teil des Ichs auf als der Markt. Der Markt ruft unser Eigeninteresse auf. Er richtet uns auf das aus, was wir »kriegen« können. Sind wir Teil einer größeren Gemeinschaft oder einer sozialen Bewegung, denken wir eher darüber nach, was uns mit anderen verbindet, und was wir geben könnten.
Was sollen die Leute aus deinen Vorträgen mitnehmen?
Mindestens drei Dinge: Eines ist, dass der Markt tief in uns eindringt. Er ist nicht bloß ein externes System, er ist mit einer Kultur verbunden, die unsere Suche nach Befriedigung und Sinn beeinflusst. Es geht nicht nur um das, »was« wir wollen, sondern auch um das »Wie«. Wenn wir uns eine »perfekte« Geburtstagsfeier oder Hochzeit wünschen, geht es um das Ergebnis, das wir da kaufen. Wir hören dann auf, an dem Prozess Freude zu haben – das gemeinsame Kuchenbacken oder das Aufblasen der Ballons. Mein Buch fordert uns auf, darüber nachzudenken, inwiefern wir beeinflusst werden, ab welchem Punkt wir uns abgrenzen.
Die zweite Botschaft betrifft den Kern des Problems – das sich vergrößernde Ungleichgewicht zwischen dem Markt und allem anderen (dem Staat, der Zivilgesellschaft, den Familien). Unsere Kultur ist nicht in Ordnung, wir setzen aber nicht an der richtigen Stelle an, um dies zu korrigieren. Wir bemühen uns um ein Gleichgewicht zwischen der Legislative, Exekutive und Judikative – und ignorieren dabei den Markt. Wir sind in einer merkwürdigen politischen Situation. Wir reduzieren Staatsausgaben, wir privatisieren Gefängnisse, Parks, Schulen und Büchereien. Wir schrumpfen die öffentliche Sphäre zusammen. Und jetzt machen wir das auch mit unserem Privatleben?
Drittens wird uns etwas vorgemacht: Immer wird behauptet, dass die Maßnahmen, die den freien Markt begünstigen – Deregulierung, Einschnitte bei den öffentlichen Dienstleistungen, Privatisierung –, familienkompatibel sind oder gar Familien stärken. Tatsächlich haben sie oft unbeachtete Nachteile. Die Deregulierung von Fernsehwerbung für Junk Food macht Kinder übergewichtig und anfällig für Diabetes. Einschnitte beim Personal in öffentlichen Bibliotheken, bei den Öffnungszeiten von Parks, bei Freizeitprogrammen für Kinder – all das schädigt Familien. Eine Steuerstruktur, die die gesellschaftliche Klassenspaltung vergrößert, schädigt die physische und psychische Gesundheit der Armen, aber auch die der Mittelklasse. Und diese selbstbezogene, am Markt orientierte Denkweise steht einer Denkweise entgegen, die auf einem »wir« aufbaut, die die Zufriedenheit innerhalb von Lebensgemeinschaften in den Mittelpunkt stellt.
Das Interview erschien zuerst auf www.alternet.org. Aus dem Amerikanischen von Alexander Gallas