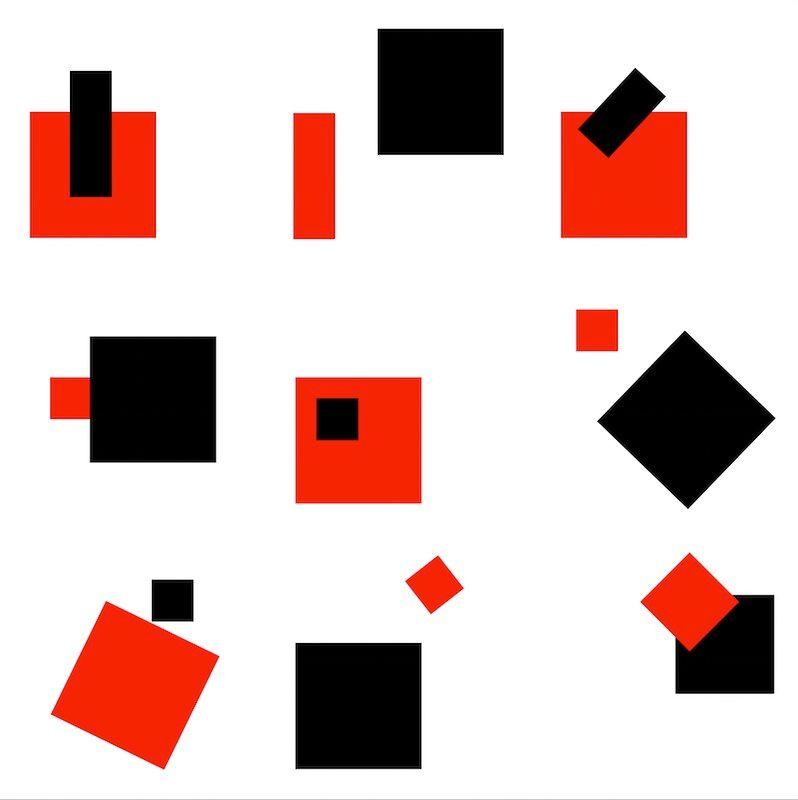die Überwindung der Berliner Bankenkrise, den Erhalt der Berliner Sparkasse als öffentlich-rechtliches Institut, die Sanierung öffentlicher Unternehmen, eine Schulreform mit der Abschaffung der Hauptschule und der Einführung von Gemeinschaftsschulen, die Pionierrolle unter den Bundesländern bei der Einführung des Vergabemindestlohns, eine der im Bundesvergleich weitestgehenden Regelungen zur Volksgesetzgebung und vieles mehr. Trotz dieser Erfolge verlor die LINKE im Ergebnis der Regierungsbeteiligung massiv an Stimmen.
[1] Denn der Großteil der Wähler*innen hatte mit einer linken Partei in der Regierung andere Erwartungen verbunden. Zwar hatten sie mit ihrer Wahlentscheidung auch eine Überwindung der Banken- und Finanzkrise erwartet, diese aber nicht mit harten Einschnitten bei der Sanierung der öffentlichen Finanzen in Verbindung gebracht. Im Wahlkampf hatte die PDS mit Gregor Gysi als Kandidat für das Amt des Regierenden Bürgermeisters Erwartungen geschürt, die mit der folgenden Realität der Regierungspolitik wenig zu tun hatten: „Der Gysi-Wahlkampf begann als Bürgermeister-Wahlkampf – und somit schon mit einem unrealistischen Ziel“, er war ein „Wahlkampf der Euphorie und der Versprechungen“. Er bediente eine vorhandene Stimmung in der eigenen Wählerschaft „als könnte nun die elf Jahre gefesselte Ost-Partei allen zeigen, wie man es im Handstreich besser macht“, resümierte 2006 Thomas Falkner.
[2]
Joachim Raschke formulierte einmal provokant, Regieren sei das „systematische Enttäuschen von Erwartungen, die man in der Opposition geschaffen hat und deretwegen man in die Regierung kam.“ (Raschke 1993, 773) Tatsächlich wird es meist so sein, dass in der Regierungspraxis nicht alle (geweckten) Erwartungen erfüllt werden können – sei es, weil eine vollständige Umsetzung mit den Koalitionspartnern nicht möglich war, die Umsetzung sich in der Realität als komplizierter auf Grund rechtlicher Probleme, Schwierigkeiten der Umsetzung in der Verwaltung usw. erwiesen hat. Solange die Richtung stimmt, sind diese Probleme kommunizierbar und kein „Bruch von Wahlversprechen“. Wenn aber die Kluft zwischen Erwartungen an die Partei in der Regierung und der tatsächlichen Regierungspraxis zu groß wird, führt dies zu einer Abwendung von Wähler*innen und zu einem gravierenden Vertrauensverlust – wie damals in Berlin geschehen.
Schlimmeres zu verhindern ist noch kein Erfolg
Im Vorfeld zu einem Regierungseintritt müssen deshalb klar definierte politische Ziele und (Einstiegs-)Projekte formuliert werden. Sie müssen gesellschaftlich mobilisierungsfähig und zugleich grundsätzlich rechtlich, finanziell und verwaltungstechnisch umsetzbar sein. Auch wenn im „komplexen Prozess der Strukturierung von Erwartungen“ die Partei nur ein Akteur unter vielen ist (s.o.), muss sie in ihrem Agieren versuchen, in diesen Prozess so einzugreifen, dass die Kluft zwischen den Erwartungen der eigenen Wähler*innen und dem Regierungshandeln nicht zu groß wird. Das war in Berlin 2001ff. unbestreitbar nicht gelungen.
Entscheidend für die Frage, ob eine Regierungsbeteiligung erfolgreich war oder nicht, ist nicht die Binnenwahrnehmung der Akteure in Regierung, Fraktion und Partei, sondern die Wahrnehmung der Wähler*innen. Auch hier zeigt die Erfahrung, dass dies oft auseinanderklafft. Während es für die Handelnden in Regierung und Fraktion als Erfolg erscheinen mag, wenn nach harten internen Kämpfen eine Verschlechterung verhindert oder auch nur abgemildert werden konnte, ist dies in der Außenwirkung meist wenig relevant. Die Verteidigung des Status quo – z.B. die Verhinderung einer Fahrpreiserhöhung – gilt den Wähler*innen als „normal“, spielt im kollektiven Gedächtnis keine positive Rolle. Werden die Fahrpreise aber nach hartem koalitionsinternen Ringen geringfügig erhöht, ist in der öffentlichen Wahrnehmung die Botschaft „Fahrpreise werden erhöht“ dominant, obwohl ein Vorstoß des Koalitionspartners für eine massive Erhöhung abgewehrt und somit „Schlimmeres verhindert“ wurde.“ Nun kann es sein, dass man in der Regierungspraxis derartige Kompromisse machen muss – man sollte sich aber hüten diese als Erfolge zu „verkaufen“. Sie müssen dann stattdessen durch wirkliche Erfolge und Fortschritte wettgemacht werden, die auch außerhalb der Partei als solche wahrgenommen werden.
Barack Obama sagte unlängst in einem Interview, er sei nicht wegen der Details seines Programms gewählt worden, sondern wegen der „Story“, die mit seiner Kandidatur verbunden war. Eine politische Erzählung ist mehr als die Summe der Forderungen eines Wahlprogramms. Eine mobilisierende politische Erzählung ist „Diagnose einer aktuellen Lebenslage und zugleich Motivation und Handlungsperspektive für die Zukunft.“ (Buttlaff/Bausch 2019, 82) Sie muss eine integrierende Funktion unterschiedlicher gesellschaftlicher und politischer Milieus haben, sie muss vermitteln, „wie die verschiedenen Entwicklungen zusammenhängen und wie auf dieser Grundlage Gegenwart und Zukunft zu deuten sind. (…) Sie stellt die nötige Verbindung her zwischen den Einzelmaßnahmen, vermittelt zwischen Identitäten und Klassenlagen und schafft so erst Gemeinschaft, wo vorher Fremdheit herrschte.“ (ebd.)
Wem gehört die Stadt?
Das Beispiel einer solchen gelungenen Erzählung war die Wahlkampagne der LINKEN zu den Berliner Abgeordnetenhauswahlen 2016. Mit der Frage „Wem gehört die Stadt?“ griff DIE LINKE das Gefühl vieler Berliner*innen auf, mit einer zunehmenden Entfremdung und Enteignung der Stadt, in der sie leben, konfrontiert zu sein. Der Kampf gegen explodierende Mieten angesichts der Spekulationswelle nach der weltweiten Finanz- und Wirtschafskrise, fehlende Investitionen in die öffentlichen Infrastrukturen, Unzufriedenheit mit einer noch immer autofixierten Verkehrspolitik, die Enteignung, die mit den Privatisierungen der Vergangenheit verbunden ist, die zunehmende Verdrängung von politisch-kulturellen Freiräumen und die Auslieferung der Stadt und ihrer Lebensräume an Kapitalinteressen – all diese Motive und noch viele mehr konnten in der Kampagne aufgegriffen werden. Mit dem Slogan „Wir holen uns die Stadt zurück“ war ein Leitmotiv für das linke Regierungshandeln und eine mobilisierende Perspektive zugleich formuliert. Entscheidend war und ist, dass DIE LINKE als kämpfende Partei in der Regierung wie außerparlamentarisch wahrgenommen wird, dass sie bereit ist Konflikte einzugehen – mit den Koalitionspartnern, aber vor allem mit Kapitalinteressen. Mit der umfangreichen Ausübung des kommunalen Vorkaufsrechts, dem bundesweit beachteten Mietendeckel und der Unterstützung des Volksentscheids „Deutsche Wohnen enteignen“, massiven Investitionen in die öffentliche Infrastruktur und Rekommunalisierungen deckt sich das Regierungshandeln mit der Erzählung von der Wiederaneignung der Stadt. Gleichzeitig gibt es eine enge Kooperation mit den gesellschaftlichen Bewegungen, ihre Mobilisierungen und ihren Druck versucht die LINKE in Regierungshandeln zu übersetzen und als Stärkung ihrer Position zu verstehen. Dass gesellschaftliche Bewegungen mit ihren Forderungen und Mobilisierungen einen Überschuss über das aktuelle Regierungshandeln produzieren, muss von den Akteuren in Regierung und Fraktion nicht als störende Uneinsichtigkeit gegenüber den jeweils real existierenden Handlungsspielräumen in der Regierung verstanden und zurückgewiesen werden, sondern im Gegenteil als Möglichkeit, Kräfteverhältnisse und gesellschaftlichen Konsens weiter nach links zu verschieben. So war es ein Fehler, während Rot-Rot den Volksentscheid zur Offenlegung der Privatisierungsverträge wegen einer verfassungswidrigen Formulierung des Gesetzestextes nicht unterstützt zu haben. Denn die Bewegung hat sich nicht um juristische Details geschert. Es ging letztlich um die massenhafte Artikulation des Willens zur Rekommunalisierung der Wasserbetriebe, was von der Partei aktiv hätte unterstützt werden müssen. Dass die Regierungsmitglieder und die Fraktion sich gegen eine Unterstützung des Volksentscheids durch die Partei eingesetzt hatten, zeigt, dass wir uns in der Regierungslogik und juristischen Überlegungen verfangen hatten.
„Man muss den bürgerlichen Apparat beherrschen und kennen, wenn man ihn ausnützen soll. Das sind anscheinend kleine, nebensächliche Geschichten, die aber für uns von großer Bedeutung waren.“[3]
Tritt DIE LINKE in die Regierung ein, übernimmt sie die Führung einer Ministerialverwaltung, eines Apparats für den die Umsetzung linker Politik alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist. Die Verwaltungsmitarbeiter*innen haben in der Regel eine andere politische Ausrichtung – oft sind sie Mitglieder anderer Parteien. Ministerien, die lange von CDU, SPD oder FDP geführt wurden, sind dann auch in ihrer politischen Ausrichtung davon geprägt – schon weil die Besetzung der Führungspositionen oft nach Parteibuch erfolgte. Zudem vertreten die unterschiedlichen Ressorts auch unterschiedliche Interessen, sind mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen und Klassenfraktionen verbunden, sind für die Aktivität unterschiedlicher Lobbygruppen empfänglich und in ihrem Selbstverständnis davon geprägt. Gleichzeitig sind die Verwaltungen als bürokratische Apparate per Definition nicht bewegungsorientiert, erstmal in technokratischer Routine befangen und in der Regel politisch anders ausgerichtet. Die Ressorts befinden sich untereinander in Konflikt und artikulieren dabei unterschiedliche gesellschaftliche Interessenlagen. Die permanente Auseinandersetzung zwischen Umwelt – und Wirtschaftsministerium oder zwischen dem Arbeits- und Sozialministerium mit dem Wirtschaftsministerium stehen für diese Kämpfe zwischen verschiedenen Staatsapparaten. Deshalb ist auch bei der Frage der Ressortzuschnitte und bei der Entscheidung, welches Ressort man als LINKE übernehmen will, wichtig zu beachten, welche Interessen sich über welche Staatsapparate artikulieren. Dabei sollte man nicht nur darauf achten, dass man den Zugriff auf die den politischen Schwerpunkten der LINKEN „nahestehende“ Ressorts wie Arbeit und Soziales erhält. Es kann auch wichtig sein, den Zugriff auf tendenziell die Verwirklichung linker Politik behindernde Ressorts zu bekommen. So kann es sinnvoll sein – um bei der oben angesprochenen „natürlichen Gegnerschaft“ zwischen dem Umwelt- und Wirtschaftsministerium zu bleiben – den Versuch zu unternehmen, den Zugriff auf beide Ressorts zu bekommen, um einerseits die Blockade des Wirtschaftsministeriums gegen effektiven Umwelt- und Klimaschutz zu brechen und im besten Fall sogar Initiativen zur Ökologisierung der Wirtschaft zu ergreifen. Während der Zeit der rot-grünen Bundesregierung bedeutete die Zusammenlegung des Arbeitsressorts mit dem Wirtschaftsressort die Unterordnung der Arbeitsmarktpolitik unter das neoliberale Dogma – unter einer linken Minister*in könnte ein solcher Ressortzuschnitt aber die Chance zu einer beschäftigungssichernden und arbeitsplatzschaffenden Politik bieten. Ein besonderes Augenmerk ist auf Querschnittsressorts zu legen. Diese haben erhebliches Störpotenzial und eine hohe Blockademacht . Offensichtlich ist dies für das Finanzressort, da alle finanzwirksamen Vorlagen von diesem mitgezeichnet werden müssen und auch schon im Rahmen der Haushaltsaufstellung Handlungsspielräume für Fachressorts beschnitten oder ausgeweitet werden können. Gesetzentwürfe müssen alle vom Justizressort mitgezeichnet werden. Und last but not least spielt die Staatskanzlei eine entscheidende Rolle – sie hat über die sogenannten „Spiegelreferate“ und die Richtlinienkompetenz der Regierungschef*in Möglichkeiten, gegenüber den einzelnen Ressorts zu intervenieren. Es ist deshalb sinnvoll – wenn auch nicht immer realisierbar – eines der Querschnittsressorts in die eigenen Erwägungen über die Ressortbesetzungen jenseits der „Gestaltungsressorts“ zu erwägen. Auf jeden Fall sollte man versuchen, eigenes Personal in der Staatskanzlei zu etablieren.
Bei allen Konflikten zwischen den Staatsapparaten gibt es aber eine grundlegend gemeinsame und integrierende Grundhaltung. So formuliert Poulantzas: „Die herrschende Ideologie, die der Staat reproduziert und indoktriniert, übernimmt auch die Funktion der Zementierung des Staatsapparats nach innen und der Einheit ihres Personals. Diese Ideologie ist die Ideologie des neutralen Staats als dem Vertreter des Allgemeininteresses und Allgemeinwohls, als dem Schiedsrichter über dem Klassenkampf: Verwaltung und Justiz stehen über den Klassen.“ Das Selbstverständnis der Verwaltung ist das einer politischen Neutralität. Die Grundhaltung ist die Bereitschaft jeder politischen Leitung „zu dienen“, gleich in welcher Partei der Minister oder die Ministerin angehört. Damit korrespondiert jedoch der (nicht nur scherzhaft gemeinte) Spruch: „Es ist doch mir egal, welcher Minister unter mir arbeitet.“ Verwaltungsmitarbeiter unterscheiden oft zwischen einer „fachlichen Meinung“ und einer „politischen Meinung“. Die fachliche Meinung wird oftmals mit dem Gestus der vermeintlich wissenschaftlichen Objektivität versehen, während der „politischen Meinung“ der Minister*in der Geruch des subjektiven Voluntarismus anhaftet. Aber – stellt Poulantzas fest – trotzdem begreifen oft „ganze Teilbereiche des staatlichen Personals diese Themen der herrschenden Ideologie als ihre eigene Aufgabe: die Herstellung von ‚sozialer Gerechtigkeit‘ und ‚Chancengleichheit‘, sowie die Herstellung eines ‚Gleichgewichts‘ zugunsten der ‚Schwachen‘.“(Poulantzas 2002, 187)
[4]
Die Verwaltung transformieren
In der Regel kommen Linke mit wenigen Vertrauten – persönlichen Referent*innen, Büroleiter*innen, Staatsekretär*innen, Pressesprecher*innen – an die Spitze einer Verwaltung mit mehreren hundert Mitarbeiter*innen, von denen nur wenige Mitglieder oder Wähler*innen der LINKEN sind. Anknüpfend am Selbstverständnis der Verwaltung als politisch neutral gilt es im intensiven Dialog deutlich zu machen, dass man gemeinsam an der Umsetzung der im Koalitionsvertrag vereinbarten Ziele arbeiten will und dabei auf die fachliche Kompetenz der Mitarbeiter*innen angewiesen ist. Und das ist auch tatsächlich so: Denn bei aller bürokratischen Routine der Ministerialapparate besitzen die Verwaltungsmitarbeiter*innen einen großen Schatz an Erfahrungs- und Fachwissen. Es gilt dies produktiv für die angestrebte politische Neuorientierung zu nutzen. Gleichzeitig aber gilt es die Rolle der Verwaltung im politischen Prozess neu zu definieren, zu „transformieren“. Denn auch eine Verwaltung, die die neue politische Spitze unterstützt, stellt „weder die Reproduktion der gesellschaftlichen Arbeitsteilung im Staatsapparat – die hierarchische Bürokratisierung – in Frage, noch grundsätzlich die im Staat verkörperte politische Spaltung in „Leitende“ und „Geleitete“ (ebd., 188). Die Verwaltung auf ‚unsere Seite’ zu bringen, reicht also nicht. Es ist notwendig sich aus der Verwaltung in die Zivilgesellschaft heraus zu begeben, dies aber zusammen mit der Verwaltung zu tun. So habe ich während meiner Regierungszeit als Wirtschaftssenator Diskussions- und Kooperationsstrukturen bestehend aus Gewerkschaften, Betriebsräten, Betriebsleitungen, Wissenschaftler*innen und der Verwaltung entwickelt. In diesem Format wurden gemeinsame Entwicklungsstrategien für Branchen und teilweise auch einzelne Unternehmen u.a. zur Sicherung von Arbeitsplätzen entwickelt. Diese wurden dann Bestandteil der Regierungspolitik. Die Implementierung dieser Strategien erfolgte arbeitsteilig durch die verschiedenen Akteure, die Administration war dabei nur ein – wenn auch wichtiger – Akteur unter anderen. Ein weiteres Beispiel ist der Entstehungsprozess des bundesweit ersten integrierten Mobilitätsgesetzes. Den Anstoß gab eine von LINKEN und Grünen unterstützte Initiative für einen Volksentscheid zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur. In den Koalitionsverhandlungen wurde durchgesetzt, ein Mobilitätsgesetz mit diesen Initiativen gemeinsam und kooperativ zu entwickeln. In einer Art „Rundem Tisch“, bestehend aus den Initiatoren des Volksentscheids, Verkehrsinitiativen, Vertreter*innen der Koalitionsfraktionen und der Verwaltungen, wurden die Inhalte des Gesetzes intensiv gemeinsam erarbeitet und anschießend von der Verwaltung in Gesetzesform gebracht.
Selbstverständlich gibt es auch Widerstände aus der Verwaltung sowohl gegenüber solchen Verfahren als auch gegenüber konkreten, die bisherige Praxis verlassende oder gar konterkarierende politische Vorhaben. „Selbstverständlich“, schreibt Poulantzas, „muss man auch hier die Widerstände dieses Personals betonen, von jenem Personal ganz zu schweigen, das seiner Rolle als Wachhund des Blocks an der Macht treu bleibt.“ (ebd., 189) Umorganisation in der Verwaltung und Neubesetzung von Leitungspositionen auf Abteilungs- und Referatsebene sind ein mögliches Instrument, um Widerstände im Apparat zu überwinden bzw. zu reduzieren. Dabei ist es jedoch ein vorsichtiges Vorgehen ratsam. Das öffentliche Dienstrecht setzt hier Grenzen und politisch motivierte Versetzung „ungeliebter“ Verwaltungsmitarbeiter*innen kann zu kontraproduktiven Effekten führen, wenn es zu Unmut, Demotivation und Widerstand in weiteren Teilen der Verwaltung führt. Umso wichtiger ist deshalb, diejenigen Teile der Verwaltung zu identifizieren und zu stützen, die bereit sind, loyal und aktiv die politischen Reformziele umzusetzen und diese nicht nur mürrisch zu dulden. Mit diesen Teilen der Verwaltung gilt es eine „Koalition der Willigen“ zu bilden. Wenn es gelingt, dass diese aktiven, grundsätzlich positiv gegenüber den neuen Zielen eingestellten Teile der Administration das Arbeitsklima in der Verwaltung bestimmen, ist viel gewonnen.
Das Instrument der abweichenden fachlichen Meinung
Gleichzeitig ist es hin und wieder notwendig, Widerstände von Verwaltungsmitarbeiter*innen zu überwinden. Diese kommen meist im schon erwähnten Gewand einer „fachlichen Meinung“ daher. Als wir einen Vergabemindestlohn einführen wollten, wurde mir als „fachliche Stellungnahme“ mitgeteilt, dies sei nach dem sogenannten „Rüffert-Urteil“ des EUGH europarechtlich nicht möglich. Daraufhin gaben wir zwei Professorengutachten in Auftrag, die der Stellungnahme der Verwaltung widersprachen und einen europarechtlich zulässigen Weg aufzeigten. Ähnlich auch, als ich den zuständigen Verwaltungsmitarbeiter*innen die Überlegung vortrug, ein Kartellverfahren gegen die überhöhten Wasserpreise und die Renditegarantien für die Privatinvestoren der teilprivatisierten Wasserbetriebe einzuleiten. Erst als ich auch hier ein externes Rechtsgutachten vorlegte, konnte der Widerstand aus der Verwaltung überwunden werden und das Bundeskartellamt erfolgreich das Verfahren gegen die Wasserbetriebe durchführen.
Das Beispiel des Berliner Mietendeckels zeigt, dass auch aus den Reihen der Administration überraschende Vorstöße für progressive Politik kommen können – aber auch die Widerstände anderer Teile der Verwaltung. Es illustriert, dass sich „die Widersprüche zwischen den herrschenden Klassen und beherrschten Klassen (…) sich als Distanzierung dieser Teile des staatlichen Personals von den eigentlichen bourgeoisen Spitzen aus(wirken) und (…) sich in Spaltungen, Rissen und Brüchen im Inneren des Personals und der Staatsapparate manifestieren.“ (ebd., 187) Die Idee des Mietendeckels stammt von einem Juristen der Pankower Bezirksverwaltung, der in einer juristischen Fachzeitschrift argumentierte, dass nach der Föderalismusreform die Zuständigkeit für das Wohnungswesen vom Bund auf die Länder übergegangen war und damit die Möglichkeit einer öffentlich-rechtlichen Preiskontrolle durch die Länder gegeben war. Damit war das allgemeine – auch von uns bislang vertretene Mantra – Mietpreisregulierung sei Bundesrecht obsolet. Vor dem Hintergrund der Mietpreisexplosion und der breiten Mobilisierung der Mieterbewegung entstand so aus den Reihen des Verwaltungspersonal ein Vorschlag im Interesse der Mieter*innen und eines Eingriffs in die Eigentumsrechte und Verwertungsinteressen des Immobilienkapitals. Es verwundert nicht, dass dieser Vorstoß auf den Widerstand anderer Teile der Verwaltung traf. Die konkrete Entwicklung des Mietendeckels erfolgte deshalb zu großen Teilen außerhalb der Administration in Diskussionen mit fortschrittlichen Jurist*innen und Akteuren der Mietenbewegung.
Volksentscheide als Instrument linker Politik
Als ein wichtiges Instrument linker Politik – auch in der Regierung – hat sich die Nutzung der Möglichkeiten der Gesetzgebung durch Volksentscheid erwiesen. 2006 wurden mit der rot-roten Koalition die Möglichkeiten der Volksgesetzgebung erheblich erweitert und wird seitdem in großem Umfang genutzt. Damit wurde den außerparlamentarischen Bewegungen ermöglicht über die Mobilisierung der Bevölkerung direkt und wirkungsvoll in die Gesetzgebung einzugreifen und damit den Zwang zur Kompromissbildung zwischen den Koalitionsparteien und den verschiedenen Ressorts/Staatsapparaten entweder gänzlich zu umgehen oder die Regierung und Administration zum Kompromiss mit der Bewegung zu zwingen. Beispiele u.a. hierfür sind der Berliner Volksentscheid zur Rekommunalisierung der Energieversorgung von 2013, der zwar um wenige Stimmen das Quorum verfehlte, aber dennoch wirksam war: Berlin baute einen kommunalen Energieversorger auf, der 100 Prozent erneuerbare Energien produziert. Und nach langen juristischen Auseinandersetzungen mit Vattenfall wird jetzt das Stromnetz in kommunales Eigentum übergehen. Mit dem Mietenvolksentscheid wurde die Mietenbewegung zu einem starken Verhandlungspartner der Regierung, mit dem Volksentscheid zur Enteignung von Deutsche Wohnen & Co. wird eine Forderung auf die politische Agenda gesetzt, die in Koalitionsverhandlungen alleine nicht durchsetzbar gewesen wäre.
Linke in der Regierung müssen lernen, die Klaviatur des bürgerlichen Staatsapparats zu beherrschen und diese Apparate zu nutzen, ohne sich in der administrativen Logik zu verlieren. Es gilt auf mehreren Ebenen zu agieren, im Staat und der Verwaltung wie mit den gesellschaftlichen Bewegungen. Ziel muss sein, Partizipation, Selbstorganisation und Selbstermächtigung der zivilgesellschaftlichen Akteure zu stärken. Wie schrieb Franz Grillparzer so treffend: „Im Staat geht’s wie in der Welt: Wer nicht schwimmen kann, der ersäuft.“ (Grillparzer o.J., 83)
Literatur
Brandler, Heinrich, 1924: Die deutschen Ereignisse. Das Präsidium des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale zur deutschen Frage/Januar 1924, Hamburg
Buttlaff, Felix/Bausch, Robert, 2019: Partei ohne Erzählung: Die Existenzkrise der SPD, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, 8/2019, 82
Grillparzer, Franz, o.J.: Studien zur Philosophie und Religion. Historische und politische Studien, Hamburg
Nullmeier, Frank. 1993: Dilemmata grüner Regierungspolitik, in: Joachim Raschke, Die Grünen. Wie sie wurden, was sie sind, Köln, 822-826
Poulantzas, Nicos, 2002 (1978): Staatsheorie. Politischer Überbau, Ideologie, Autoritärer Etatismus, Hamburg
Raschke, Joachim, (Hg.) 1993: Die Grünen. Wie sie wurden, was sie sind, Köln
Wolf, Harald, 2016: Rot-Rot in Berlin. Eine (selbst-)kritische Bilanz, Hamburg
Anmerkungen
[1] Die im Wahlkampf geschürten hohen und unrealistischen Erwartungen und die Diskrepanz zur Regierungspraxis sind allerdings nur ein Faktor für die Stimmverluste gewesen, andere Fehler kamen hinzu. Siehe dazu ausführlicher: Wolf 2016.
[2] Siehe dazu ausführlicher Harald Wolf 2016, 318.
[3] Heinrich Brandler über die kurze Episode der SPD/KPD-Regierung in Thüringen 1923, in: ders. 1924, 24. Die deutschen Ereignisse. Das Präsidium des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale zur deutschen Frage/Januar 1924, Hamburg 1924, S.24
[4] Nicos Poulantzas 2002: Staatsheorie. Politischer Überbau, Ideologie, Autoritärer Etatismus, Hamburg (Erstausgabe 1978), 187