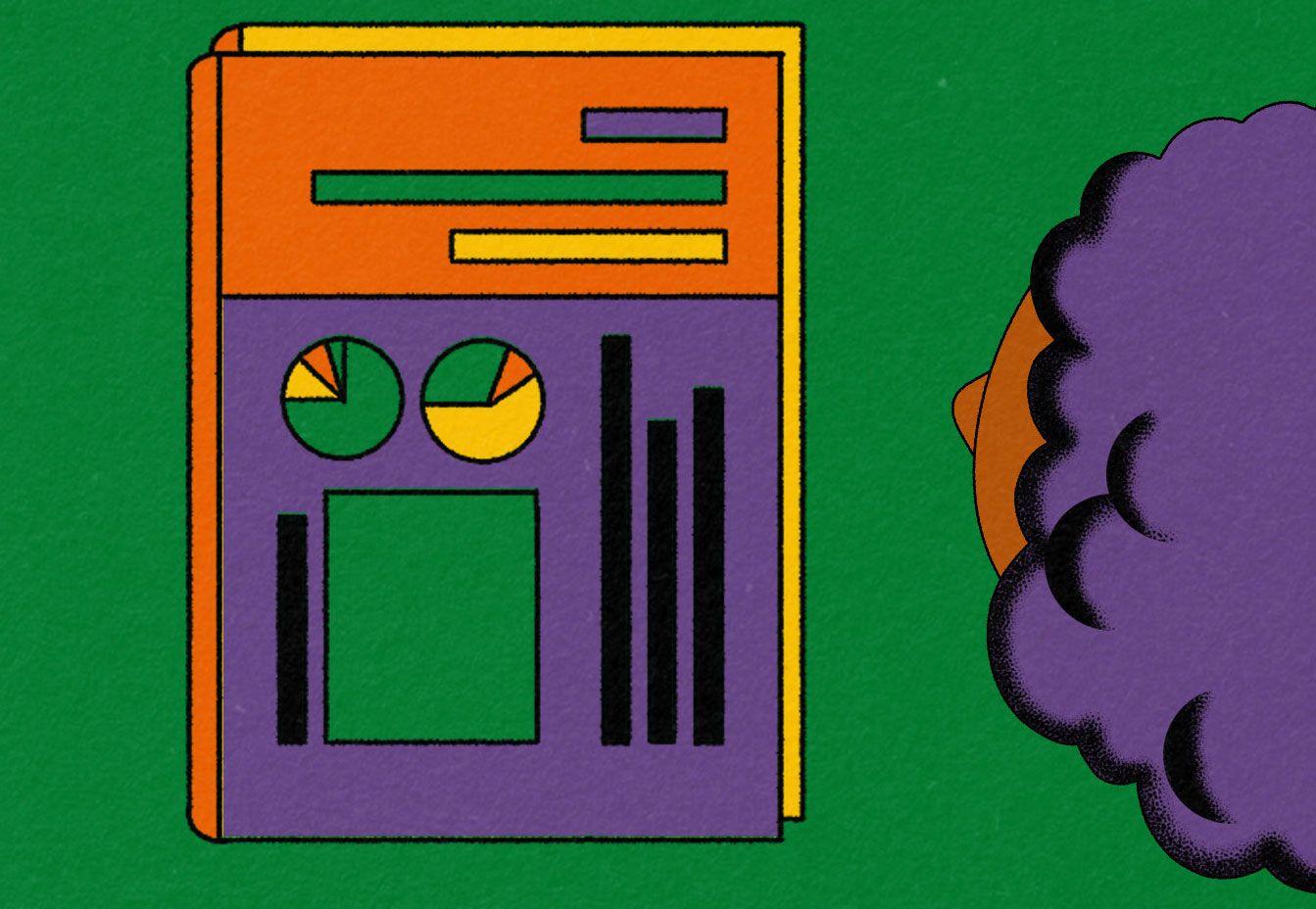In jeder Sekunde muss exakt so viel Strom produziert werden, wie verbraucht wird. Ein solches Gleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot herzustellen, erfordert zielführende Planung und hocheffiziente Koordination. Umso mehr, weil der naturgemäß schwankende Anteil an Wind- und Photovoltaik-Anlagen wächst und immer mehr dezentrale Stromerzeuger hinzukommen. Insgesamt klappt das erstaunlich gut: Nur zwölf Minuten fällt der Strom hierzulande durchschnittlich pro Jahr aus – international ein Spitzenwert.
Nicht nur diese tägliche Einsatzroutine ist eine komplexe Planungsaufgabe, sondern auch das großflächige Umlenken von Investitionen über mehrere Jahrzehnte. Dies dürfte ein Grund dafür sein, warum nur wenige Bereiche kapitalistischer Volkswirtschaften so umfangreich staatlich geplant und reguliert sind wie der Stromsektor. Das war selbstverständlich kein Selbstläufer und ist keineswegs ausreichend: Etliches läuft hier alles andere als perfekt, vor allem gemessen an den Herausforderungen des Klimawandels und der sozialen Gerechtigkeit. Im Vergleich zum Mobilitäts- oder Gebäudesektor, in denen der klimagerechte Umbau schlicht katastrophal ausgebremst wird, ist die Dekarbonisierung in der Elektrizitätswirtschaft aber durchaus vorangekommen. Im letzten Jahr betrug der Ökostromanteil knapp 52 Prozent des Bruttostromverbrauchs.
Daher lohnt es, sich im Kontext neuer linker Planungsdebatten speziell den Strombereich genauer anzuschauen. Hier finden sich Ansätze für eine zukunftsfähige Politik, etwa Instrumente zur Grobsteuerung der Emissionsmenge von Treibhausgasen und zum Ökostromausbau. Sie zeigen auch, warum Planung nicht vollkommen auf Marktmechanismen verzichten sollte.
Von Paris in die Steckdose
Im Grunde genommen beginnt der Planungsprozess für den Stromsektor in Paris und Brüssel. Das Pariser Klimaschutzabkommen gab im Jahr 2015 das völkerrechtlich verbindliche Ziel aus, den Ausstoß von Treibhausgasen so zu vermindern, dass die 1,5- bis 2-Grad-Grenze nicht überschritten wird. Die Europäische Union schnürte 2021 zur Umsetzung das sogenannte Fit-for-55-Paket. Die Zahl steht für 55 Prozent Emissionsminderung bis 2030 gegenüber 1990. Zuvor waren im EU-Klimaschutzgesetz nur 40 Prozent angepeilt. Klimaneutral soll die EU bis 2050 werden. Diese Strategie teilt den in der EU noch erlaubten Ausstoß von Treibhausgasen in zwei Säulen auf. Es handelt sich zum einen um das eigens reformierte Europäische Emissionshandelssystem für Energiewirtschaft und Industrie (ETS) und zum anderen um die novellierte EU-Lastenteilungsverordnung, die all jene Bereiche der Volkswirtschaften umfasst, die nicht unter das ETS fallen, wie Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft.
Das Emissionshandelssystem soll dieser Strategie zufolge bis 2030 62 Prozent Treibhausgasemissionen gegenüber 2005 einsparen, in den anderen Bereichen sollen es 40 Prozent sein. Aus Sicht von Umweltverbänden und Wissenschaft ist das weiterhin zu wenig für einen fairen Beitrag Europas zum Erreichen der Paris-Ziele. Doch auch diese Zielvorgaben erfordern, dass sich die jährliche Einsparung in der EU gegenüber dem Durchschnitt der zwei letzten Jahrzehnte um den Faktor 2,5 erhöht. Auch der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch müsste jährlich mehr als doppelt so stark wachsen. Das macht die gewaltige Herausforderung deutlich – und ist zugleich ein Beleg für viel zu spätes Handeln. Die Ziele könnten und müssten ambitionierter sein, aber das liegt nicht an fehlenden Steuerungsinstrumenten, sondern an fehlenden politischen Mehrheiten.
Im Bereich des Emissionshandelssystems für die Energiewirtschaft und Industrie hat Brüssel das zulässige Klimagasbudget, eine der wichtigsten Plangrößen der EU, in der Tat deutlich reduziert. Zugleich wurden Mechanismen verschärft, die überschüssige Emissionsrechte aus vergangenen Handelsperioden abbauen und Missbrauch verhindern sollen. Auch das Volumen an Treibhausgasen, das in den Bereichen Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft emittiert werden darf, wurde gekürzt. Im Unterschied zum Emissionshandel, dessen jährliche Ziele und Regeln EU-weit gelten, werden die Ziele hier auf die Mitgliedstaaten aufgeteilt. Deutschland muss entsprechend (von 2005 bis 2030) um 50 Prozent reduzieren, Polen etwa um 18 Prozent.
Kohleausstieg nach Plan oder per Preis?
Innerhalb des Europäischen Emissionshandelssystems müssen Energiewirtschaft und Industrie nun mit deutlich weniger CO2-Zertifikaten auskommen als bisher. Das lineare Tempo der Minderung wurde zu Beginn dieses Jahres fast verdoppelt, auf 4,3 Prozent jährlich. Erstmals seit Schaffung des ETS-Markts 2005 könnten die Emissionsrechte wirklich knapp werden. Entsprechend sind die Preise der CO2-Zertifikate seit 2021 förmlich explodiert: von jahrelang deutlich unter 25 Euro auf zeitweise bis zu 100 Euro pro Tonne im letzten Jahr. Expert*innen erwarten, dass der Kohleausstieg in Europa marktgetrieben schneller stattfinden wird, als es das deutsche Kohleausstiegsgesetz vorsieht, nämlich bereits 2030 statt 2035 oder gar 2038.
Darüber hinaus spielt das Emissionssystem eine Schlüsselrolle dafür, welche der fossilen Kraftwerke tagtäglich zum Einsatz kommen (»Dispatch«). Die hohen CO2-Preise machen schon jetzt für etliche Stunden des Jahres emissionsstarke Braunkohlekraftwerke unrentabel, sodass sie an der Strombörse immer weniger zum Zug kommen. Trotz der zunehmenden Wirksamkeit dieser Mengensteuerung bleibt ein Kohleausstiegsgesetz wichtig – wenn es auch deutlich ambitionierter sein müsste. Denn sowohl Kraftwerksbetreiber wie Kohlekumpel und Reviere brauchen Planungssicherheit.
Über ihre Zukunft und den finalen Abschaltzeitpunkt der Meiler vor Ort dürfen nicht CO2- und Brennstoffpreise entscheiden. Umgekehrt hat das Kohleausstiegsgesetz keinen Einfluss auf den täglichen Kraftwerks-Dispatch. Es könnte die Wirkung des Emissionshandelssystems also nicht vollständig ersetzen, denn dieses erfasst auch den Industriesektor mit seinen Zehntausenden von Anwendungen, die dem Ordnungsrecht kaum oder nur mit extrem hohem Aufwand zugänglich wären.
Ökostrom: Geplanter Ausbau
Im Elektrizitätssektor gibt es staatliche Planziele für den Ausbau von Alternativen zu Kohle und Gas. So hat die Bundesregierung bis 2040 Ziele für den Ausbau des Ökostroms festgelegt, die sich rechnerisch (vereinfacht) aus einer Vielzahl von Faktoren ableiten: den erwarteten Volllaststunden der Wind-, Solar- und Biomassekraftwerke, dem vollzogenen Atomausstieg, dem angestrebten Ende der Kohleverstromung 2030, dem bis 2040 verfügbaren restlichen fossilen Anlagenbestand, dem geplanten Aufwuchs zusätzlicher Stromverbraucher aus E-Mobilität, Wärmepumpen und Wasserstoff-Elektrolyseuren sowie aus den zu erwartenden Stromeinsparungen.
Die offiziellen Pläne kommen den aufwendigen Modellierungen einer Studie von Agora Energiewende (2021) ziemlich nahe. Umgesetzt werden die Pläne eines zusätzlichen Ökostromausbaus über eine grobe Steuerung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Entsprechend dem angepeilten Strommengenpfad (in Gigawatt installierter Leistung bis 2040) sind dort vierteljährliche Ausschreibungsmengen verankert für neue Windkraft-, Photovoltaik- und Biomasse-Anlagen. Das Kriterium für den Zuschlag ist eine möglichst niedrige Förderhöhe der jeweiligen Neuanlage. Damit soll die finanzielle Belastung so gering wie möglich gehalten, aber die Rentabilität der Anlage sichergestellt werden. Ein spezieller Korrekturfaktor bei der Bewertung der Angebote soll Windkraftanlagen in weniger windreichen Regionen und damit eine bessere geografische Verteilung ermöglichen. Dies wird jedoch durch die teils restriktiven Abstandsregeln zur Wohnbebauung in den südlichen Bundesländern oder schlicht durch eine geringe Verfügbarkeit von Flächen verhindert.
Kleinere Anlagen sowie Bürgerenergieanlagen können sich dem aufwendigen Ausschreibungssystem entziehen. Für sie gilt weiterhin die garantierte technologiespezifische Einspeisevergütung. Diese hat seit der Einführung des EEG im Jahr 2000 den Ausbau von Ökostromanlagen vorangetrieben, im Zusammenspiel mit dem dort verankerten Vorrang bei der Einspeisung von Ökostrom. Das Ausschreibungs- und Marktprämiensystem wurde erst 2017 unter der Großen Koalition eingeführt. Es sollte die Förderhöhe, die bis dahin staatlich festgelegt worden war und deren Angemessenheit schwer abzuschätzen war, näher an die Erzeugungskosten bringen. Zudem sollte der Ökostromausbau auf diese Weise besser mit dem Netzausbau koordiniert werden. Auch wenn der Ausbau erneuerbarer Energien in dieser Zeit durch den Umbruch in der Förderarchitektur und durch politische Eingriffe unverantwortlich abgebremst wurde: Das EEG ist als gezieltes Technologieförder- und Planungsinstrument insgesamt ein beachtlicher Erfolg. Jede zweite in Deutschland verbrauchte Kilowattstunde ist heute Ökostrom.
Umkämpfte Netzentwicklung
Noch ein kurzer Blick auf den Netzbetrieb der Höchstspannungsebene, für den vier Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) verantwortlich sind. Auch diese vier haben Pläne, und zwar Fahrpläne im Viertelstundentakt. Die eingehenden Meldungen der Stromproduzenten über Prognosen der Erzeugung verrechnen die ÜNB mit den Anmeldungen der Vertriebe über die voraussichtliche Nachfrage. Sie prüfen, steuern und gleichen mit Betriebseingriffen in den Anlagenpark in Sekundenpräzision die Strombilanzen aus, um Netzüberlastungen oder Fehlmengen zu verhindern. Die (teils privaten) Übertragungsnetzbetreiber planen zudem – anknüpfend an die volkswirtschaftliche Strommengenplanung – den für die Energiewende notwendigen Ausbau der Höchstspannungstrassen. Sie entwickeln dafür Netzentwicklungspläne auf Basis unterschiedlicher Szenariorahmen, die sie fortschreiben. Die staatliche Bundesnetzagentur prüft und korrigiert die Dokumente, schließlich geht es um ein natürliches Monopol, das reguliert werden muss. Am Ende wird der Ausbau vom Bundestag durch ein Bundesbedarfsplangesetz beschlossen, das etwa alle vier Jahre fortgeschrieben wird.
Netzplanungen stoßen aber regelmäßig auf Gegenwind, so auch der Ausbau von Stromtrassen, der sich um Jahre verzögern kann. Ein Grund dafür ist das Misstrauen vieler Bürgerinitiativen, die gegen die Betreiber klagen. Der Verdacht: Die vier Unternehmen schieben der Bundesnetzagentur als Verfahrensträger überzogene Ausbaupläne unter. Sie sind schließlich Eigentümer der womöglich zu umfangreichen Netze, für deren Betrieb es eine Garantieverzinsung gibt. Ob dieser Vorwurf stichhaltig ist, ist in der Fachwelt umstritten. Progressive Akteure fordern aber, den Planungsprozess, der dem politischen Beschluss vorangeht, in ein öffentliches Fachgremium auszulagern. DIE LINKE geht einen Schritt weiter: Übertragungsnetze (ebenso wie das künftige Wasserstoffnetz) gehören ihr zufolge in die Hand eines einzigen und staatlichen Netzbetreibers, wie es in vielen Nachbarländern Usus ist, etwa in Frankreich, Dänemark oder Holland. Dies soll Kosten einsparen und Misstrauen vorbeugen.
Notwendige Preissignale in einem ungerechten Markt
An der Strombörse richten die Erzeuger ihr Angebot an ihren Betriebskosten aus, den Brennstoff- und CO2-Kosten. An der Börse ist es aber der Zuschlagspreis für den letzten noch benötigten Stromproduzenten (das sogenannte Grenzkraftwerk, häufig ein Gaskraftwerk), der den Preis für alle Bietenden vorgibt, also auch für die, die ihren Strom preiswerter verkaufen wollen. Darum ist das System anfällig für Übergewinne, auch wenn etwa Braun- und Steinkohlekraftwerke mit ihren geringeren Brennstoffkosten durchaus deutlich höhere Fixkosten haben als Gaskraftwerke. Jahrzehntelang haben ausgerechnet Betreiber von Braunkohle- und Atomkraftwerken, aber auch von großen Wasserkraftanlagen prächtig verdient – auf Kosten von privaten Haushalten und Gewerbe.
Bei externen Preisschocks wie in der jüngsten Gaskrise werden Verbraucher*innen besonders übervorteilt. So waren 2022 die Gasturbinen besonders teuer zu befeuern, während sich die laufenden Kosten für Kohle- und Atom- sowie Wasserkraftanlagen und Windparks kaum geändert hatten. So konnten deren Betreiber gigantische Übergewinne erzielen. Die politischen Möglichkeiten, diese Gewinne abzuschöpfen, blieben ungenutzt. Dennoch: Die Preissignale der Börse sind unverzichtbar für die Koordinierung von Hunderttausenden von Stromeinspeisern und einer schwankenden regenerativen Erzeugung des Stroms. Diese Signale zeigen etwa an, wann wetterbedingt viel Strom vorhanden ist und wann wenig. Ein regeneratives System ist auf eine flexible Nachfrage und damit auf Preissignale angewiesen, wenn es nicht deutlich mehr Kapazitäten vorhalten will als zwingend nötig.
Demokratische Mehrheiten für eine kluge Instrumentierung
Planung kann nur mit den geeigneten Instrumenten (Ordnungsrecht, Förderpolitik und staatliche Infrastrukturinvestitionen) funktionieren und wenn ihre Umsetzung nicht von Konzernen oder Lobbyisten behindert werden kann. Das zeigen die größtenteils gescheiterten Pläne im Nachgang des Pariser Klima-Abkommens. Die nationalen Klimapläne von fast 200 Staaten werden die weltweiten Emissionen von 2019 bis 2030 wohl nicht um die geplanten 43 Prozent senken, sondern lediglich um zwei Prozent (UNFCC 2023). Schuld sind neben den unzureichend untersetzten Plänen von Politik und Verwaltungen auch die Abwehrkämpfe der mächtigen fossilen Wirtschaft sowie die fehlende finanzielle Unterstützung für ärmere Länder. Selbst Deutschland könnte laut einer Prognose seine Verpflichtungen verfehlen und bis 2030 eine Klimaschutzlücke von 331 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent gegenüber dem Plan aufweisen (Umweltbundesamt 2023). Verantwortlich ist nicht die Energiewirtschaft, die die Ziele des Klimaschutzgesetzes deutlich übererfüllt, sondern insbesondere der Verkehrs- und Gebäudesektor, für den die Ampel keine wirksamen Umsetzungsinstrumente geschaffen hat.
Planung ist letztlich nicht mehr als ein Instrument. Kluge und lernfähige Planung muss dort, wo es notwendig ist, auch eine Feinsteuerung über Preismechanismen zulassen. Nur so kann es ihr gelingen, sowohl tägliche Dispatch-Routinen wie langfristige Umbauprozesse zu steuern. Zentrale Vorgaben müssen mit wirksamen Instrumenten auf die untergeordneten Ebenen transportiert werden. Planungsvorhaben müssen als lernende und rollierende, also in regelmäßigen Abständen zu korrigierende Prozesse angelegt sein. Eine solche Flexibilität ist notwendig, weil ein erfolgreicher Planungsprozess dezentrale Planungen und Projekte nicht nur zulassen, sondern unterstützen muss. Entsprechend muss er mit Regulierungs-, Koordinierungs- und Förder-instrumenten untersetzt sein, die Technologieentwicklung und Klimaschutzvorhaben »von unten« ermöglichen. Das EEG ist in weiten Teilen ein Beispiel dafür.
Um dies zu organisieren, ist nicht weniger, sondern mehr und bessere Planung vonnöten, nicht nur im Strombereich. So plädiert eine Analyse der Universität Weimar für eine »Systementwicklungsplanung« auf dem Weg zur Klimaneutralität: Ein öffentliches Planungsregime müsse »auf die Identifikation von aus einer Gesamtsystemsicht und insofern aus gesamtwirtschaftlicher Sicht vorteilhaften Koordinationsentscheidungen ausgerichtet sein« (Vorwerk u. a. 2023). Die Mängel der aktuellen Planungsprozesse machen demgegenüber klar: Die konkreten Machtverhältnisse sind entscheidend dafür, welche Zielpfade in diesen Prozessen festgelegt werden, inwiefern diese realisiert werden können und welche Verteilungswirkungen sie haben. Der Erfolg insbesondere von Infrastrukturvorhaben wird stark vom demokratischen Gehalt des jeweiligen Planungsprozesses beeinflusst – auch weil fehlende Akzeptanz die Umsetzung bremsen kann. Der Druck von Klimaschutz- und sozialen Bewegungen und die faktische Kraft von eigenmächtigen Klimaschutzinvestitionen beeinflussen das politische Umfeld von Planungsprozessen in positiver Weise. Dies gilt leider unter umgekehrten Vorzeichen auch für die Aktivitäten der Gegenseite.