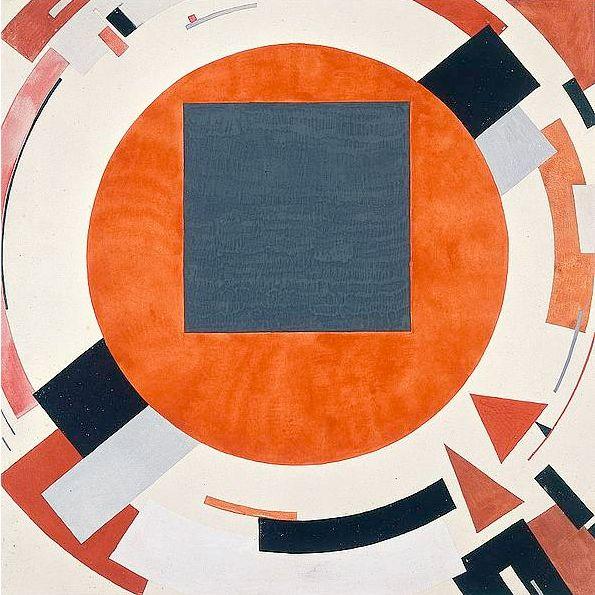Ein Blick zurück auf die letzten Jahre verdeutlicht, dass unsere politische Gesamtrechnung nicht nur gesellschaftliche Wahrscheinlichkeiten, sondern auch Unvorhersehbares, Überraschungen mit einkalkulieren muss. Dennoch ist die Richtung, die gerade bundespolitisch eingeschlagen wird, recht eindeutig: eine grün-ökologische Modernisierung unter konservativen, austeritätspolitischen Vorzeichen mit etwas mehr Staatsaktivität als bisher. Sprich: eine schwarz-grüne Koalition aus einer in der Pandemie sich wieder stabilisierenden CDU und den mit neuem Grundsatzprogramm selbstbewusst auf Regierungskurs steuernden Grünen ist das wahrscheinliche Szenario. Zweifellos ist das ein attraktives mehrheitsfähiges Projekt. Aber gewiss auch eines, in dem die Grünen ein großes sozialökologisches Potenzial links liegen lassen (Jäger 2020). Denn weder ökologisch noch sozial werden die Grünen mit der CDU/CSU ihre proklamierten Ziele umsetzen können. Als neue Regierungspartei könnten sie ein irgendwie vorwärtsweisendes Projekt repräsentieren, aber nicht länger glaubwürdig für eine konsequente (und soziale) Klimapolitik stehen – das spürt die Klimabewegung schon jetzt.
Ist eine Diskussion über die Bedingungen linker Zukunftsprojekte und linken Regierens vor schwarz-grünem Hintergrund deswegen hinfällig oder bitter notwendig? Ich würde sagen Letzteres. Denn erstens müssen wir die Bedingungen für eine Veränderung nach links selbst herstellen, mit realistischem Blick, was machbar ist. Die Frage, ob dabei ein wirklicher Richtungswechsel mit Regierung oder mit einem gesellschaftlichen Projekt vielversprechender ist, scheint mir einen falschen Gegensatz aufzumachen, denn beides wird kaum in Reinform gelingen. Zweitens sollte von links gerade in der derzeitigen Situation keine harte Abgrenzung zu den Grünen oder zur SPD erfolgen, obschon die Unterschiede in der Reichweite und Form unserer Politik deutlich werden müssen. Unsere Gegner sind nicht rot oder grün, sondern eine mögliche schwarz-grüne (oder grün-schwarze) Koalition sowie die radikale Rechte. Ein Gebrauchswert der LINKEN ist nun einmal auch, die SPD und vor allem die Grünen nicht einem kapitalistischen Modernisierungskurs zu überlassen bzw. ein „Weiter so“ zu erlauben. Es gilt also, deren eigene linken Ansprüche zu stärken, die sie nur mit der LINKEN, mit niemanden sonst umsetzen können. Aber wie geht das?
Aus Erfahrungen lernen
Unabhängig davon, ob die Umfragen es derzeit hergeben, macht es Sinn, über Erfahrungen des Regierens zu diskutieren. Ohne kritischen Blick, aber auch ohne Blick auf Gelingendes verschenken wir sonst viel. Nun kennen wir alle zahlreiche Beispiele, in denen linkes Regieren unter sehr ungünstigen Bedingungen nicht oder kaum gelang. Leere Kassen, ungünstige Kräfteverhältnisse in Gesellschaft und Koalitionsregierungen oder auch offene Feindschaften mit übermächtigen Gegnern wie der Troika in Griechenland haben linkes Regieren nahezu verunmöglicht. Das heißt: In Zeiten sattelfester Hegemonie des Neoliberalismus waren die allermeisten Regierungsbeteiligungen von Linken zum Scheitern verurteilt. Die Situation ist heute eine andere. Inzwischen sind die Parteiensysteme überall in heftiger Bewegung, auch bei uns. Innerhalb des herrschenden Machtblocks finden Kämpfe um seine Führung und Zusammensetzung statt, um zukünftige gesellschaftliche Projekte. Die neoliberale Hegemonie ist vorüber, ohne dass etwas Neues etabliert werden konnte. In solchen Zeiten entstehen Verschiebungen und Spielräume – freilich können diese auch wieder verschwinden.
Manchmal wiederum hatten linke Parteien kaum eine Wahl, als sich an der Regierung zu beteiligen: ob nun 1996 mit dem L’Ulivo-Bündnis zur Verhinderung einer zweiten Regierung Berlusconi in Italien oder zur Beendigung der korrupten CDU-Regierung in Berlin. Allerdings waren die Folgen für die Linke fatal. In Berlin entfremdete die rot-rote Koalition (2002 bis 2011) die Partei DIE LINKE auf Jahre von vielen Wähler*innen und sozialen Bewegungen, in Italien zerstörte und zersplitterte die Regierungsbeteiligung die Linke, die sich bis heute nicht davon erholt hat.
Es gibt jedoch auch Beispiele für eine gelungene Zusammenarbeit aus jüngerer Zeit, darunter Portugal mit einem Tolerierungsmodell auf Vertragsgrundlage (vgl. Candeias 2017). Auch mit der zweiten Regierungsbeteiligung der LINKEN in Berlin sind einige positive Erfahrungen verbunden. Auch wenn das Berliner Beispiel nicht überstrapaziert werden darf, zeigt sich hier grundsätzlich, dass es geht, dass die gesellschaftliche und die Parteilinke in der Lage sind, zu lernen und durch eine effektive Arbeitsteilung gemeinsam Erfolge zu erringen. All das wäre nicht ohne die zähe und langfristige Organisierungsarbeit von Initiativen, Bewegungen sowie der Partei möglich gewesen. Berlin zeigt uns daher außerdem: Der Hauptfokus der Partei sollte dringend beim „Verbinden, Verankern, Verbreitern, Organisieren“ (Riexinger/Kipping 2013) bleiben. Die Partei muss selbst ein organisierender Akteur in der Gesellschaft sein. Sie muss in enger Verbindung mit Bewegungen, gewerkschaftlichen Akteuren und linken Organisationen agieren, um im Falle einer Regierungsbeteiligung etwas erreichen zu können.
So zentral und effektiv die Strategie einer verbindenden Klassenpolitik und der Organisierung von unten ist (vgl. Riexinger 2018; Zeitschrift LuXemburg 2017), der Aufbau einer aktiven Mitgliederpartei, die Verstetigung verbindender Klassenpolitik oder systematisches Organizing, all das braucht Zeit und ist längst noch nicht überall in der Partei oder in den sozialen Bewegungen verankert. Gleichzeitig gibt es auf Bundesebene zahlreiche und überraschend starke Proteste und Bewegungen, die gesellschaftliche Diskurse verschieben und die mit einer echten Ansprechpartnerin in der Regierung ihren Druck von unten auf die gesetzliche Ebene übersetzen könnten. Und hier kommt eben trotz des unerlässlichen Aufbaus von unten die Debatte um eine Linksregierung oder linke Mehrheiten (Kipping 2020) nicht nur, aber auch im Bund ins Spiel. Dabei geht es nicht um ein R2G, das arithmetisch möglich ist. Es darf nicht einfach das Ziel sein mitzuregieren, sondern der Fokus muss sein, real einen Unterschied machen zu wollen. Somit wäre die wichtigste Voraussetzung einer bestandsfähigen Politik der Hoffnung (Brie/Candeias 2016): Regieren nur, wenn ein Richtungswechsel möglich ist.
Produktive Konflikte suchen
Linkes Regieren muss unmittelbare Verbesserungen bringen, zugleich Macht- und Eigentumsverhältnisse verändern. Entscheidend ist es daher, einige Projekte zu bestimmen, die gezielt beispielgebende Konflikte produzieren, so wie der „Mietendeckel“, die Kampagne „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ oder auch die Streiks um Personalbemessung an der Charité, denen Arbeitskämpfe an weiteren Kliniken folgten. Noch vor eineinhalb Jahren hätten wir gedacht, dass eine Kampagne für die Enteignung von Immobilienkonzernen unter keinen Umständen Erfolg haben kann. Doch es zeigte sich, dass ein solcher Konflikt Sichtbarkeit verleiht, inspiriert und motiviert. Wenn eine Kampagne um einen solchen Konflikt wirkt, verschiebt sie den gesellschaftlichen Diskurs, sie erweitert den Möglichkeitsraum und erhöht die Durchsetzungsfähigkeit auch anderer Forderungen. So hat die Enteignungskampagne unmittelbar das Diskursfeld für den „Mietendeckel“ verbessert und gleichzeitig radikale Überlegungen für andere gesellschaftliche Bereiche und Auseinandersetzungen angestoßen. Hinzu kommt, dass auch für jene, die selbst nicht aktiv werden wollen oder können, solche Projekte eine neue Attraktivität ausstrahlen können: Sie sehen, hier legt sich jemand für uns mit den mächtigen Interessen an, um real etwas für alle zu erreichen. Ein Projekt linken Regierens muss sich also die Frage stellen, welches die drei bis vier zentralen gesellschaftlichen Fragen sind, die gelöst werden müssen und die geeignet sind, einen solchen, für die Linke produktiven Konflikt zu entwickeln?
Das heißt, für jede Art von Regierungsbeteiligung, egal ob im Bund oder in den Ländern, ist die Bestimmung von einigen wenigen und durchaus ambitionierten und konfliktträchtigen Projekten notwendig, die wir in jedem Fall realisieren wollen. Dabei hilft auch die Identifizierung linker Versatzstücke in der Programmatik potenzieller Koalitionspartner, in denen die gemeinsamen Punkte des linkssozialen und linksökologischen gesellschaftlichen Feldes deutlich werden. Sind diese gemeinsamen Punkte gefunden, kann in angestrebten Koalitionen darüber gestritten werden, auf welche „Mindestprojekte“ man sich einigt.
In der gegebenen gesellschaftlichen Situation sehe ich die folgenden Konfliktfelder, die es gilt, produktiv zu machen:
- Wohnen für alle: Mietendeckel/Enteignung/massive Investition in den sozialen Wohnungsbau;
- sanktionsfreie Grundsicherung und Grundrente, die allen zugutekommt;
- radikaler Klimaschutz durch massiven Ausbau des Umweltverbundes im Verkehr und neue Jobs durch alternative industrielle Produktion;
- massiver Ausbau der sozialen Infrastrukturen mit vernünftiger und verbindlicher Personalbemessung und ihrer Rekommunalisierung sowie Abschaffung der privaten Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung und Einführung einer Bürgerversicherung für alle;
- Einstiege in die kurze Vollzeit für alle mit neuem Normalarbeitsverhältnis, ein höherer Mindestlohn sowie Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen;
- deutliche Reduzierung von Rüstungsexporten (mit Verbot von Lieferungen in Krisengebiete bzw. in an Konflikten beteiligte Staaten wie die Türkei oder Saudi-Arabien);
- Wiedereinführung der Vermögens- und Erhöhung von Unternehmenssteuern, eine Finanztransaktionssteuer, Steuervollzug bei transnationalen und Tech-Konzernen, Reform der Grundsteuer – also der Knackpunkt einer Linksregierung, um das alles finanzieren zu können. Substanzielle Fortschritte in diesem Bereich sind der Lackmustest für einen Richtungswechsel.
Ein Beispiel, wie ein "Mindestprojekt" aussehen kann
Pandemiebedingt lohnt es sich ein mögliches „Mindestprojekt“ für den Bereich Gesundheit zu diskutieren. In der Pandemie wurden Pfleger*innen zu nationalen Held*innen erhoben. Mehr als symbolische Anerkennung haben die „Systemrelevanten“ jedoch nicht bekommen. Und dennoch ist durch den Diskurs der Systemrelevanz eine besondere Ausgangslage entstanden, die Potenzial in sich trägt: Nötige Verbesserung der Arbeitsbedingungen lassen sich seit Corona noch viel eindringlicher thematisieren und zugleich mit einer Kritik am System der Fallpauschalen (DRGs) verbinden. Die DRGs stehen gegenwärtig stark in der Kritik und das nicht nur durch die vielen Streiks von Pflegenden in den letzten Jahren, sondern erstmals auch vonseiten der Krankenhausgesellschaften. Und auch ver.di kritisiert noch grundlegender als zuvor dieses Finanzierungsmodell. Das bedeutet, durch den Diskurs der Systemrelevanz hat sich der Diskurs rund um die Ökonomie der Krankenhäuser verschoben. Und erste Schritte mussten infolge des Drucks von unten bereits vollzogen werden – etwa, dass die Kosten für die Pflege aus einer Finanzierung nach Fallpauschalen herausgenommen oder sogenannte Vorhaltekosten für „zusätzliche“ Behandlungskapazitäten eingeführt wurden.
Diese Schritte gilt es nun weiter voranzutreiben durch Forderungen nach einer adäquaten Personalbemessung sowie nach einer alternativen Bedarfsermittlung, -planung und -finanzierung. Das bedeutet, es besteht eine Chance, über den breiten Konsens, dass Pflegekräften mehr Anerkennung verdienen, auch weitergehende Problematiken des Gesundheitswesens im öffentlichen Bewusstsein stärker zu verankern.
Die Forderungen und Kampagnen für eine sofortige (Lohn-)Zulage von 500 Euro pro Monat für die „systemrelevanten Berufe“, wie es unter anderem ver.di und die LINKE fordern, ist ein Einstieg (vgl. LINKE 2020). Weitergehende Forderungen, wie beispielsweise eine generelle Anhebung der Löhne, müssten jetzt folgen. Die Tarifrunde im öffentlichen Dienst im Herbst 2020 war ein erster Schritt: In der Pflege wurde eine Gehaltsteigerung von 8,7 Prozent und für Intensivkräfte von rund zehn Prozent erkämpft. Hinzu kommt eine einmalige Corona-Prämie von 600 Euro. Neben den Lohnerhöhungen gilt es, um bessere Standards in der Personalbemessung zu kämpfen. Hier kann an unterschiedliche Volksbegehren-Initiativen etwa in Bremen, Nordrhein-Westfalen und Berlin angeknüpft werden.
Sogar Gesundheitsminister Jens Spahn sieht, dass die Zahl der Intensivbetten mit entsprechender Ausrüstung dauerhaft verdoppelt werden sollte. Eine Verdoppelung der Betten hieße aber auch, dass etwa das Vierfache an qualifiziertem Personal nötig wäre, um diese Betten betreiben zu können. Das wiederum erfordert weitere 100.000 Pflegekräfte, die schon vor der Corona-Krise fehlten, wie eine Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung aus diesem Jahr zeigt (Heintze u.a. 2020). Jens Spahns Lösung für dieses Problem folgt jedoch der Bertelsmann-Manier: Wenn es zu wenig Personal gibt, dann müssen wir Krankenhäuser schließen. Dann haben auch die übrig gebliebenen Krankenhäuser mehr Pflegekräfte. Hier zeichnet sich die nächste große Auseinandersetzung ab.
Vor diesem Hintergrund sollte es um eine Rekommunalisierung bzw. Vergesellschaftung von Krankenhäusern gehen. Ökonomisierung und Privatisierung haben zum Abbau eines qualitativ hochwertigen und flächendeckenden Angebots geführt, indem nur betrieben wird, was sich rechnet (also z.B. keine Geburtshilfe, keine Notaufnahme etc.). Ein inspirierendes Beispiel kommt aus Hessen: Ver.di und die LINKE Hessen starteten hier eine Kampagne, um das Marburger Uni-Klinikum im Eigentum der Rhön-AG wieder in öffentlichen Besitz zu überführen. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung unterstützt dieses Vorhaben mit einem juristischen Gutachten (Wieland 2021). Zusätzlich bedarf es an gezielter Recherche, etwa zu den Praktiken und Machenschaften bestimmter Krankenhauskonzerne wie Fresenius. (Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat dazu eine Studie in Auftrag gegeben, die Anfang 2021 erscheinen wird; Redler 2021). Zusammen mit der Bundestagsfraktion organisiert die Stiftung zudem einen Ratschlag zur Pflege, um mit Aktivist*innen aus Gewerkschaften, Bewegungen und Partei über die Fortführung gemeinsamer Kampagnen zu diskutieren. In diesem Bereich ist die Linke gut aufgestellt. Und auch ohne Regierungsbeteiligung wird dieses Thema weiter zu verfolgen sein.
Nichtsdestotrotz wäre es für all das sehr hilfreich, auch ein Bundesministerium im Rücken zu haben, denn viele der skizzierten Forderungen sind gegen die CDU/CSU kaum durchzusetzen. Hinzu kommt, dass viele Angelegenheiten nicht Ländersache sind. Zu den Möglichkeiten, die dennoch auf Länderebene machbar sind, hat die Rosa-Luxemburg-Stifung ebenfalls ein juristisches Gutachten erstellt (Baunack 2020), sowie eine Studie zu alternativer Bedarfsplanung in Krankenhäusern auf den Weg gebracht (etwa in Bremen). Die Bremer um Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (DIE LINKE) bereiten ebenfalls Schritte vor.
DRGs, Personalbemessung, oder eben die Abschaffung der Zwei-Klassen-Medizin durch eine Bürgerversicherung für alle: Dies alles sind Angelegenheiten des Bundes. Warum machen wir aus ihnen nicht drei zentrale Bedingungen für ein „Mindestprojekt“ einer Linksregierung im Bund? Unter Spahn werden wir kaum Schritte in die gewünschte Richtung durchsetzen können. Wäre es nicht schön, anzunehmen, die LINKE hätte das Ministerium für Gesundheit und Pflege, vielleicht neben dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Wohnen und dem für Wirtschaft, Verbraucherschutz und Verkehr, um mal bescheiden bei dreien zu bleiben?
Um wirksame „Mindestprojekte“ entsprechend der oben gemachten Vorschläge zu entwickeln, bedarf es einer systematischen Vorbereitung: Welchen Konflikt sollten wir zuerst führen? Wo sind Gegner bereits angeschlagen und wo kann man unsaubere Machenschaften aufdecken und nutzen (eher bei Krankenhauskonzernen oder privaten Krankenversicherungen)? Wie sähe eine Arbeitsteilung zwischen Gewerkschaft und Bewegungen beim gemeinsamen Kampf für eine andere Pflege aus? Welches geschulte Personal brauchen wir dafür an welcher Stelle? Welche Gefahren gilt es zu bedenken, zum Beispiel: Wie stark sind die Kapitalfraktionen, die man herausfordert? Wie steht es medientechnisch um unsere Kampagne, welcher „Spin“ ist von der anderen Seite zu erwarten? Wie geht man damit um, wenn sich Koalitionspartner nicht recht trauen (Stichwort: „Mietendeckel“)? Wie lotet man rechtliche Grauzonen aus, dehnt sie möglichst weit aus und an welcher Stelle wäre sogar ein kalkulierter Regelbruch zu wagen? Wie legt man in den ersten Projekten die Schritte für folgende produktive Konflikte an?
Kurz gesagt: Wir müssen uns fragen, welche zugespitzten Projekte und Konflikte wir in den nächsten 1,5 Jahren und dann in der nächsten Legislatur verfolgen wollen und ob wir dies in der Opposition oder der Regierung tun möchten. Ich plädiere dafür, dass wir uns auf entsprechend umsetzbare Zukunftsprojekte in der kommenden Zeit konzentrieren. Im Sinne eines sozialökologischen Pols eröffnen solche Mindestprojekte eine verbindende Perspektive der Transformation, die sich auf drei Ebenen ausdrückt: „Mindestprojekte“ gehen erstens an die Wurzel des Problems, sind zweitens im selben Schritt erkennbarer Teil einer größeren Perspektive, eines sozialökologischen Systemwechsels und stärken drittens soziale Infrastrukturen mit entsprechenden Investitionen für beides. Als sozialistische Linke verknüpfen wir diese Perspektive mit einem neuen demokratischen, feministischen und grünen Sozialismus, beginnend mit dem Infrastruktursozialismus als Anspruch auf das Selbstverständliche (Candeias 2020).
„Mindestprojekte“ als Lackmustest
Haltelinien helfen nur ex negativo, aber nicht um den Gebrauchswert der Partei in einer Regierung zu verdeutlichen. Es ist allerdings auch sinnvoll, viele Dinge nicht zu tun: keine weiteren Freihandelsabkommen, keine Kampfeinsätze, keine Ausweitung der Rüstungsetats, keine Deregulierung, keine unnützen Großprojekte oder Privatisierungen usw. Und wenn hier keine Schnittmengen unter den Koalitionspartnern bestehen, schadet es eben auch nicht, wenn eine Regierung an dieser Stelle nicht regiert. Das bedeutet: Haltelinien sind wichtig und sollten neu bestimmt werden. Doch ebenso wichtig sind einige wenige, konkrete, durchaus ambitionierte „Mindestprojekte“, die in möglichen Sondierungsgesprächen den Lackmustest für eine Regierungsbeteiligung bilden. Und der praktische Nebeneffekt ist: Diese Projekte und ihre systematische Vorbereitung brauchen wir, auch wenn wir nicht regieren. Sichtbarkeit erzielen, wirkliche Veränderung und Stärkung der Linken wären die drei Kriterien. Es reicht nicht, einige gute Reformen durchzusetzen, wenn diese keine Erkennbarkeit produzieren und am Ende die LINKE dramatisch geschwächt ist. Die Frage, ob eine Regierungsbeteiligung sinnvoll ist, kann daher nicht vom Wie eines „rebellischen Regierens“ abgekoppelt werden. Das „Rebellische“ sollte nicht als Phrase oder reine Stilfrage verstanden werden: Der Stil ist wichtig, das heißt, es geht darum, proaktiv Forderungen der progressiven Zivilgesellschaft aufzunehmen, gemeinsam zu entwickeln und zu bündeln, entscheidend ist dann aber, diese in Gesetzesvorlagen zu übersetzen, die nicht nur Verbesserungen mitbringen, sondern Kräfteverhältnisse verschieben und die Kampfbedingungen verbessern.
Ohne gesellschaftlichen Druck kein Vorankommen
Insofern widerspricht ein Projekt Linksregierung auch keineswegs dem Ansatz einer von der Regierung unabhängigen und organisierenden Partei. Ohne eine solche mobilisierte Partei, ohne Engagement von Initiativen und sozialen Bewegungen wird eine Linksregierung nur wenig durchsetzen können, geschweige denn mittelfristig durchhalten können. Die gesellschaftlichen Gegenkräfte sind zu stark. In Berlin deutet sich ansatzweise an, welchen Gegenwind wir auf Bundesebene zu erwarten hätten. Auch die Beharrungskräfte bei den potenziellen Koalitionspartnern – eventuell auch in Teilen der Linkspartei – sind nicht zu unterschätzen.
Auch nach einer Übernahme der institutionellen Regierungsmacht darf sich eine Linksregierung nicht von den Bewegungen loslösen. Im Gegenteil müsste in allen Bereichen noch viel intensiver um Selbstorganisierung gerungen werden. Voraussetzung einer im Dialog stehenden Linksregierung ist daher die Entwicklung neuer verbindender Praxen zwischen den unterschiedlichen Funktionen von Regierung, Partei, Bewegung und gesellschaftlicher Selbstorganisationen. Die Erarbeitung eines gemeinsamen Aktionsplans, indem die Schritte festgehalten werden, die notwendig sind, um weiterhin gesellschaftlichen Druck zu entwickeln, ist für das Vorankommen einer Linksregierung unerlässlich. Solche gemeinsamen Kampagnen zur Erhöhung des politischen Drucks wären gerade in jenen Politikfeldern notwendig, die nicht im Zuständigkeitsbereich der LINKEN lägen. In solchen Fällen wäre eine sture oder absichtliche Konfrontation innerhalb der Koalition weniger produktiv als eine Unterstützung der auf entsprechenden Feldern aktiven Bewegungen und Organisationen. So könnte die LINKE die Belange der Bewegung und den Druck der Zivilgesellschaft in die Koalitionsgespräche tragen, den Koalitionspartnern öffentlich widersprechen, und hätte am Ende die Freiheit, entsprechenden Vorschlägen der Koalitionspartner nicht zuzustimmen (das auf Bundesebene sicherlich gravierendste Konfliktfeld wären neue Kampfeinsätze der Bundeswehr oder neue Rüstungsprojekte, mit denen man alles einreißen kann, was man andernorts aufgebaut hat. Es gäbe aber noch etliche andere Beispiele). Nur so garantieren wir Glaubwürdigkeit, gerade mit Blick auf unsere Kernprojekte. Und dort, wo Widersprüche liegen, wo wir uns nicht durchsetzen konnten, gilt es mit Ehrlichkeit und Transparenz im Gespräch zu bleiben. Allen ist klar, dass man nicht alles auf einmal erreicht.
Um von vornherein ein Grundvertrauen zu einem derartigen Projekt Linksregieren herzustellen, dürfte entscheidend sein, gleich zu Beginn zwei bis drei einschneidende Maßnahmen umzusetzen, wenn der Schwung noch da, der Gegner noch geschwächt, die Zivilgesellschaft mobilisiert ist. So könnten beispielsweise das Ende der Schuldenbremse und die rasche Einführung einer Vermögenssteuer oder einer anderen signifikanten Umverteilungsmaßnahme das entscheidende, motivierende Signal des Aufbruchs für linke Reformen mit einem finanzpolitisch handlungsfähigen Staat sein.
Ein Bundestagswahlprogramm muss umfassend sein, alle Politikbereiche einschließen, sagen, wo wir hinwollen. Demgegenüber hätte ein, sagen wir, Zehn-Punkte-Programm für eine Linksregierung einen anderen Sinn: Es wäre diskurspolitisch sinnvoll, da einerseits die Medien darauf anspringen, andererseits Raum geschaffen wird, um unsere radikalen und in ihrer Anlage sozialistischen Interventionen und „Mindestprojekte“ sichtbar zu machen, auch um die Linke selbst um die ausgewählten und eingreifenden Punkte zu reorganisieren und zu konzentrieren – unabhängig davon, ob es später zu einer Linksregierung kommen sollte oder nicht. Ein solches Zehn-Punkte-Programm sollte zusammen mit einem breiten Bündnis aus linken zivilgesellschaftlichen Gruppierungen und Wissenschafter*innen entwickelt werden. Programmatische Schnittmengen existieren bereits jetzt im Mitte-links-Spektrum, wie die gemeinsamen Papiere von IG Metall und BUND oder Fridays For Future und ver.di zeigen.
Wir sollten von der Formel R2G als arithmetisch-mediales Farbenspiel Abschied nehmen und offensiv für eine Linksregierung, neue linke Mehrheiten oder einen sozialökologischen Systemwechsel eintreten, um zu markieren, dass es uns um mehr geht als um bloßes Mitregieren. Noch bevor der Bundestagswahlkampf losgeht, bräuchte es vonseiten eines sozialen und ökologischen Pols einen entsprechenden Weckruf für einen Aufbruch, der – nach der Stilllegung vieler Proteste in der Pandemie – den Willen der Vielen wieder auf die Straße tragen kann.
Dieser Text erscheint als Teil unserer Reihe Regieren? Und wenn ja wie? Hierwerden bisherige Erfahrungen und unterschiedliche Perspektiven auf linke Regierungsbeteiligung diskutiert.